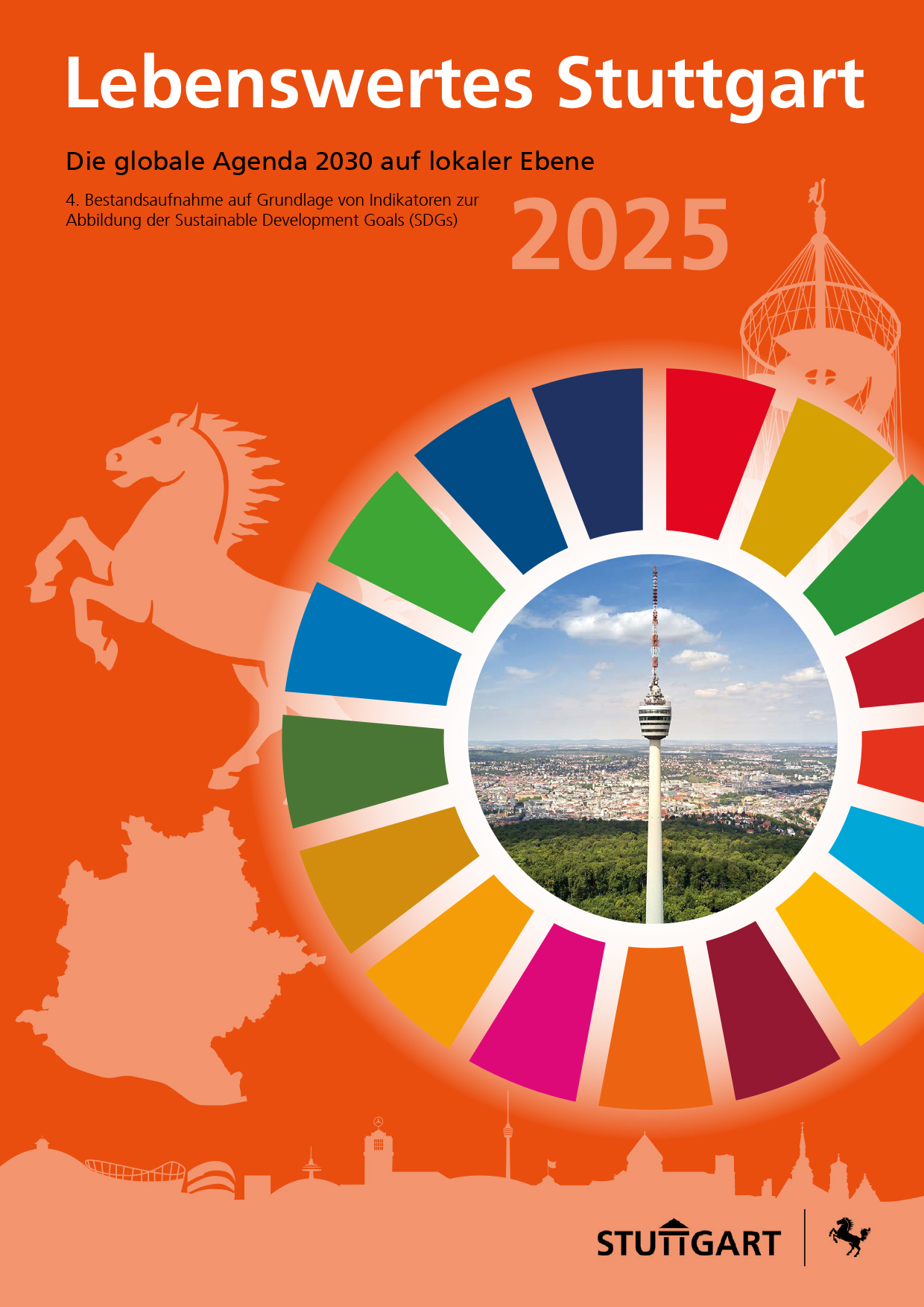Die globale Agenda 2030 auf lokaler Ebene
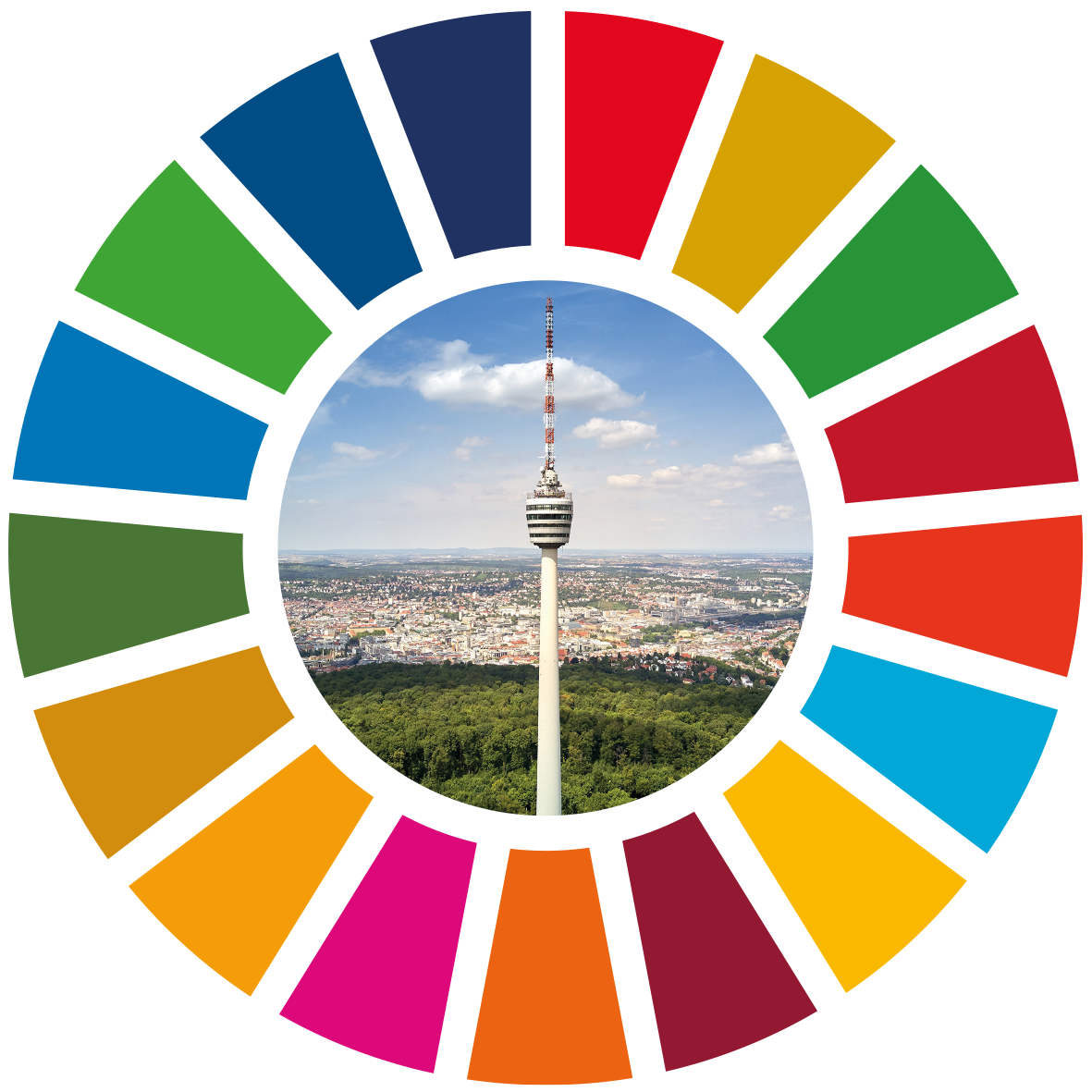
Die Agenda 2030
Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen umfasst 17 Ziele und 169 Unterziele für eine sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs). Sie bietet nicht nur Nationalstaaten, sondern auch Kommunen einen ganzheitlichen Orientierungsrahmen, um dem Strukturwandel, dem Klimawandel und sozialen Fragen auf lokaler Ebene zu begegnen.
Daten und Fakten sind eine wesentliche Voraussetzung für die effektive Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Das Dashboard ergänzt den alle zwei Jahre erscheinenden Bericht „Lebenswertes Stuttgart“. Es bietet mit einem Klick einen Überblick über die Entwicklung der im Bericht verwendeten SDG-Indikatoren in Stuttgart sowie Praxisbeispiele aus den Fachbereichen. Es ermöglicht auf anschauliche Weise ein umfassendes Monitoring der internationalen Nachhaltigkeitsziele und bietet Politik, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen über Entwicklungen und Zusammenhänge.
Der aktuelle Stand des Dashboards basiert auf der vierten SDG-Bestandsaufnahme 2025 „Lebenswertes Stuttgart“
*Zur Bestandsaufnahme 2025Global denken – lokal handeln: „Ein lebenswertes Stuttgart für Alle“*
SDG 1: Keine Armut
Relevante Themen für deutsche Kommunen sind unter anderem die Umsetzung von Sozialschutzmaßnahmen, die Sicherstellung einer breiten Versorgung von Armen und Schwachen, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit in prekären Situationen sowie auch die Mobilisierung von Ressourcen zur Beendigung von Armut in Ländern des Globalen Südens.
Folgende Unterziele des SDG 1 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

1.2 Armut um mindestens die Hälfte reduzieren
Armutsgefährdungsquote (Angaben in Prozent)
Dieser Indikator beschreibt den Anteil der Haushalte, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des Medians der Äquivalenzeinkommen der Haushalte in Stuttgart beträgt. Menschen, deren Einkommen unterhalb der 60-Prozent- Schwelle liegen, sind definitionsgemäß von relativer Armut betroffen. Für die Berechnung der Armutsgefährdungsquote werden die Angaben zu dessen Einkommen ins Verhältnis zur Haushaltsgröße gesetzt und nach dem Alter seiner Mitglieder gewichtet. Die Gewichtung erfolgt anhand einer Skala der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese Berechnungsmethode macht Haushaltseinkommen untereinander vergleichbar, wobei zu beachten ist, dass die Angaben zum Einkommen oft unvollständig sind, da kleinere oder unregelmäßige Anteile des Einkommens häufig nicht angegeben werden. Dadurch wird der Wert des Äquivalenzeinkommens unterschätzt. Auch die Einteilung des Einkommens in Einkommensklassen kann zu Unschärfe in den Ergebnissen führen, da eine Verschiebung der Klassengrenzen zu einer höheren oder niedrigeren Armutsgefährdungsquote führen kann.
Berechnung:
Anzahl Haushalte mit Einkommen < 60 % des Medians der Netto-Äquivalenzeinkommen in Stuttgart / Anzahl Privathaushalte insgesamt * 100

1.3 Sozialschutzsysteme und -maßnahmen für alle umsetzen
Bezug sozialer Mindestsicherungsleistungen (SGB II-/XII- Bezug)
Der Indikator wird berechnet als Anteil der Personen, die Leistungen nach SGB II und SGB XII oder Regelleistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, an der Einwohnerzahl. Mit der Berücksichtigung der Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz weicht die Berechnung von der ersten Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2019 ab. Zudem weichen die Werte von der Bestandsaufnahme 2023 ab, da anstelle von Stichtagswerten nun Jahresdurchschnittswerte herangezogen wurden.
Berechnung:
Anzahl Leistungsbeziehende nach SGB II und SGB XII + Anzahl Regelleist. nach Asylbewerberleistungsgesetz / Einwohnerzahl * 100
Kinderarmut
Die Kinderarmut wird berechnet als Anteil der Summe der leistungsberechtigten Personen unter 15 Jahren mit Bezügen nach dem SGB II und der nicht-leistungsberechtigten Personen unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten nach SGB II an der Einwohnerschaft unter 15 Jahren.
Berechnung:
Anzahl Leistungsberechtigte mit Bezügen nach SGB II
unter 15 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) + Anzahl nicht-leistungsberechtigter Personen unter 15 Jahren
in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten
nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (unter 15 Jahre) * 100
Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Die Armut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird berechnet als Anteil der Summe von Leistungsberechtigten nach dem SGB II zwischen 15 und 17 Jahren und von nichtleistungsberechtigten Personen zwischen 15 und 17 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigung nach SGB II an der Einwohnerzahl im Alter zwischen 15 und 17 Jahren.
Berechnung:
Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II zwischen 15 und 17 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) + Anzahl nicht-leistungsberechtigter Personen zwischen 15 und 17 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (15–17 Jahre) * 100
Armut von Älteren
Die Armut von Älteren wird berechnet als Anteil der Leistungsbeziehenden nach SGB XII ab 65 Jahren an der Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren.
Berechnung:
Anzahl Personen mit Leistungsbezügen nach SGB XII ab 65 Jahren (Jahresdurchschnittswerte) / Einwohnerzahl (ab 65 Jahre) * 100
Armut von Alleinerziehenden
Die Armut von Alleinerziehenden wird berechnet als Anteil der Leistungsbeziehenden nach SGB II an der Anzahl Alleinerziehender
Berechnung:
Anzahl Alleinerziehende mit Leistungsbezügen nach SGB II (Jahresdurchschnittswerte) / Anzahl Alleinerziehende * 100

1.4 Gleiche Rechte auf Eigentum, Grundversorgung, Technologie und wirtschaftliche Ressourcen
Wohnungslosigkeit (Angaben in Prozent)
Dieser Indikator wurde im Jahre 2023 eingeführt. Erhebungsgrundlage ist das Wohnungslosenberichterstattungsgesetz (WoBerichtsG). Berücksichtigt werden Personen, die aufgrund von Wohnungslosigkeit in Übernachtungsstellen, Notunterkünften, (teil-)stationären Einrichtungen oder anderen Angeboten der Wohnungslosenhilfe untergebracht sind. Der Anteil der untergebrachten Wohnungslosen ist mit der Gesamtheit der tatsächlich von Wohnungslosigkeit betroffenen Personen nicht gleichzusetzen. Grund hierfür ist, dass eine Erfassung aller auf der Straße lebenden oder in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit lebenden Personen nicht möglich ist. Zudem werden im Rahmen der Wohnungslosenstatistik des Statistischen Bundesamts nur Personen erfasst, die aufgrund von Wohnungslosigkeit untergebracht sind. Nicht erfasst werden wohnungslose Personen, die aufgrund eines anderen Bedarfs in einem anderen Hilfesystem (z. B. der Eingliederungshilfe) untergebracht sind.
Berechnung:
Anzahl wohnungslos untergebrachte Personen / Einwohnerzahl * 100
SDG 2: Kein Hunger
Relevante Themen des SDG 2 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Verbesserung der Ernährungssituation und die Nachhaltigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion.
Folgende Unterziele des SDG 2 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

2.2 Alle Formen der Fehlernährung beenden
Kinder mit Übergewicht (bei Einschulungsuntersuchung) (Angaben in Prozent)
Der Indikator bildet den Anteil der übergewichtigen Kinder bei der Einschulungsuntersuchung ab. Größe und Gewicht werden hier standardisiert erfasst und in den Body-Mass-Index umgerechnet. Zur Bestimmung von Übergewicht wird dann der BMI mit den alters- und geschlechtsspezifischen Werten einer Referenzbevölkerung verglichen. Der Indikator gibt den Anteil der Kinder an, deren Body-Mass-Index über einem Schwellenwert liegt. Dieser Schwellenwert wird bestimmt als der Wert, unter dem 90 Prozent aller Kinder desselben Geschlechts in der Altersgruppe in Deutschland liegen.
Berechnung:
Anzahl Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit Übergewicht / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100

2.4 Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und resiliente landwirtschaftliche Methoden
Ökologische Landwirtschaft
Daten zur ökologischen Landwirtschaft werden im Rahmen der amtlichen Agrarstrukturerhebung ungefähr alle vier Jahre erhoben. Berücksichtigt werden Betriebe ab fünf Hektar Land oder mit Mindesterzeugungseinheiten, die zumindest Teile des Betriebs nach den Richtlinien der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bewirtschaften.
Berechnung:
Fläche mit ökologischer landwirtschaftlicher Nutzung / Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung insgesamt * 100
Berechnung:
Anzahl ökologisch wirtschaftende Betriebe / Anzahl landwirtschaftliche Betriebe insgesamt * 100
Stickstoffüberschuss (Angaben in kg/ha)
Der Stickstoffüberschuss wird über Modellrechnungen ermittelt, in die der Düngemitteleinsatz, der Eintrag aus der Luft, Entnahmen durch Einträge in pflanzliche und tierische Marktprodukte sowie weitere Aspekte eingehen.
Berechnung:
Stickstoffüberschuss in Kilogramm / Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hektar * 100
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
Relevante Themen des SDG 3 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlergehens, der Prävention und Behandlung des Missbrauchs schädlicher Substanzen, des allgemeinen Zugangs zu medizinischer Versorgung und der Verringerung gesundheitlicher Belastungen aufgrund der Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden.
Folgende Unterziele des SDG 3 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

3.2 Beendigung aller vermeidbaren Todesfälle im Alter von unter 5 Jahren
Säuglingssterblichkei
Dargestellt ist die Anzahl der im ersten Lebensjahr gestorbenen Säuglinge je 1000 Lebendgeborene eines Kalenderjahres im 3-Jahres-Mittelwert. Die Säuglingssterblichkeit beinhaltet lebend geborene Kinder, die nachgeburtlich verstorben sind. Totgeborene Kinder sind darin nicht eingeschlossen. Aufgrund der geringen Fallzahlen werden Mittelwerte über drei Jahre gebildet. Die berichtete Jahreszahl bezieht sich immer auf das letzte Jahr des jeweiligen Dreijahreszeitraums (z. B. „2020“ umfasst die Daten des Dreijahreszeitraums 2018 bis 2020).
Berechnung:
Anzahl der Todesfälle von unter 1-jährigen / Anzahl aller Lebendgeborenen * 1000

3.3 Kampf gegen übertragbare Krankheiten
Impfschutz
Dieser Indikator wurde im Jahr 2025 eingeführt. Er bildet mit Blick auf den Impfschutz gegen Tetanus und Polio den prozentualen Anteil der Kinder bei der Einschulungsuntersuchung (ESU) ab, die nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) als grundimmunisiert gelten. Die ESU wird schuljahresweise durchgeführt. Die berichtete Jahreszahl bezieht sich immer auf das Jahr, in dem der Jahrgang eingeschult wird. Der Untersuchungszeitraum liegt dann immer in den beiden Jahren davor (z. B. „2023“ umfasst die Daten des Jahrgangs, der 2023 eingeschult und im Jahr 2021/2022 untersucht wurde). Der Indikator bildet hinsichtlich des Impfschutzes gegen Masern und Röteln ebenfalls den prozentualen Anteil der Kinder bei der ESU ab, die nach STIKO-Empfehlung als grundimmunisiert gelten. Kinder, die mindestens zwei Impfungen gegen Masern sowie gegen Röteln erhalten haben, gelten grundsätzlich als grundimmunisiert. In der Regel wird die Masern- und die Rötelnimpfung in einer Kombination mit der Mumpsimpfung als Dreifachimpfung verabreicht. Die Durchimpfungsrate Mumps ist jedes Jahr nahezu identisch mit der Durchimpfungsrate Röteln und wird aus diesem Grund hier nicht separat ausgewiesen. Die leicht höhere Durchimpfungsrate bei Masern im Vergleich zu Mumps und Röteln resultiert aus den vereinzelt durchgeführten Gaben von Einzelimpfstoffen gegen Masern. Auch hier beziehen sich die Angaben auf Kinder mit vorgelegten Impfdokumenten aus den Einschulungsuntersuchungen
Berechnung:
Anzahl grundimmunisierte Kinder je Krankheit
bei der Einschulungsuntersuchung / Anzahl Kinder bei der Einschulungsuntersuchung insgesamt * 1000

3.4 Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten senken und die psychische Gesundheit fördern

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Sport und Bewegung
Hier finden Sie Hilfe: Die TelefonSeelsorge ist 24 Stunden erreichbar unter: 0800 1110111

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
Kinder mit auffälligem Screening der Grobmotorik (bei Einschulungsuntersuchung)
Der Indikator bildet die Rate der Kinder mit einem auffälligen Screening der Grobmotorik (Dokumentation der Einschulungsuntersuchung) ab. Der grobmotorische Entwicklungsstand wird mit einer standardisierten Untersuchung (Einbeinhüpfen) erhoben und nach altersspezifischen Grenzwerten beurteilt. Da es sich bei der Untersuchung um ein Screening handelt, ist von einer gewissen Übererhebung auszugehen. Die Bezeichnung der Jahreszahl bezieht sich jeweils auf die Einschulungsjahre. Das bedeutet, dass das angegebene Jahr dem Jahr der Einschulung entspricht, während die Datenerhebung ungefähr 18 Monate vorher stattfand.
Berechnung:
Anzahl Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit auffälligem Screening der Grobmotorik / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100
Organisationsgrad im Sport
Sport und Bewegung gehören zu den zentralen Faktoren der Gesundheitsförderung. Neben individueller Bewegung ist vor allem die Organisation in Sportvereinen Ausdruck sportlicher Betätigung. Das Amt für Sport- und Bewegung der Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Zahl der Mitglieder in Sportvereinen nach Lebensphase. Dabei werden elf verschiedene Lebensphasen unterschieden.
Berechnung:
Anzahl in Sportvereinen organisierte Personen je Lebensphase / Einwohnerzahl (je Lebensphase) * 100
Urbane Bewegungsräume
Der Indikator bezieht sich auf Flächen, die speziell für den Sport und Bewegung ausgestattet und allgemein zugänglich sind. Hierzu zählen beispielsweise Bolzplätze, Basketballplätze, Boulebahnen oder Tischtennisplatten. Diese werden in Bezug gesetzt zu der Einwohnerzahl.
Berechnung:
Allgemein zugängliche Sportflächen in Quadratmeter / Einwohnerzahl insgesamt * 100
Bewegungsförderung in Kitas
Über die regelmäßige Teilnahme und die Anmeldungen von Kitas bei den einzelnen Teilprojekten des Programms „Bewegt aufwachsen“ wird quantitativ erhoben, wie aktiv Kitas Bewegungsförderung umsetzen.
Berechnung:
Anzahl Bewegungspass-Kitas und Anzahl zertifizierte Fachkräfte für den Bewegungspass
Sterbefälle durch Suizid
Suizid ist eine der möglichen vorzeitigen Todesursachen. Ein Suizid ist meist die Folge starker psychischer Beeinträchtigung oder Störung, weshalb die Anzahl der Sterbefälle durch Suizid hier als Indikator herangezogen werden kann. Der vollzogene Suizid ist bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt und deshalb geschlechtsspezifisch zu betrachten.
Berechnung:
Anzahl Suizide Männer bzw. Frauen / Einwohnerzahl * 100 000
Wahrnehmung von Einsamkeit
Der Indikator bezeichnet die gefühlte Einsamkeit der befragten Personen. Einsamkeit wird anhand des wissenschaftlich fundierten Fragenkatalogs von De Jong-Gierveld et al. (2006) gemessen, der aus sechs Fragen besteht.
Berechnung:
Anzahl an sich einsam fühlenden Menschen / Anzahl Befragte insgesamt * 100

3.6 Verringerung von Verkehrsunfällen und Todesfällen
Verunglückte im Verkehr
Der Indikator setzt die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Personen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Aufgrund der Verkehrsdichte in Städten und dem Zusammentreffen der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden (mit dem Auto, dem Fahrrad, zu Fuß) ist die Verkehrssicherheit ein wichtiges Thema. Der Indikator Verunglückte im Verkehr bildet ab, wie erfolgreich Maßnahmen zur Verkehrssicherheit letztlich sind. Eine Unschärfe des Indikators besteht darin, dass die Anzahl der Verunglückten - strenggenommen - ins Verhältnis zur Anzahl der Verkehrsteilnehmenden gesetzt werden müsste. Denn insbesondere Einpendlerinnen und Einpendler in die Stadt tragen neben deren Einwohnerschaft zum städtischen Verkehr bei.
Berechnung:
Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen / Einwohnerzahl * 1000

3.8 Zugang zu grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle
Zahngesundheit bei Kindern
Das Angebot für Kinder und Jugendliche in Kindertageseinrichtungen und Schulen erstreckt sich von der Untersuchung auf Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen, Erhebung des Zahnstatus, Zahnschmelzhärtung, Ernährungsberatung bis hin zur Mundhygiene. Eltern von Kleinkindern werden Sprechstunden „1x1 für Kinderzähne“ angeboten sowie Elterninformationsveranstaltungen und die Mitwirkung an zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen. An den Grundschulen werden die Klassenstufen 1, 4 und die Grundschulförderklassen (GFK) untersucht, davon an neun Karies-Prophylaxe-Programmschulen die Klassenstufen 1 bis 4. Darüber hinaus werden an Gemeinschafts- und Werkrealschulen regelmäßig die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 sowie Internationale Vorbereitungsklassen untersucht. An Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZen) finden Untersuchungen in allen Klassenstufen statt. Es werden somit mehr Kinder mit und ohne Behandlungsbedarf erreicht und an die Zahnarztpraxen zur Behandlung oder Vorsorge verwiesen. Die berichteten Zahlen beziehen sich immer auf das jeweilige Schuljahr. Der Wert für 2024 steht also für das Schuljahr 2023/2024.
Berechnung:
Anzahl Kita-Kinder mit naturgesundem Gebiss bzw.
Schulkinder mit naturgesundem bleibendem Gebiss / Zahnärztlich untersuchte Kita- bzw.
Schulkinder insgesamt * 100
Vorzeitige Sterblichkeit
Der Gesundheitszustand beeinflusst maßgeblich die Lebensqualität der Menschen. Treten Todesfälle in einem Alter von unter 65 Jahren gehäuft auf, so können dies Anzeichen für massive Gesundheitsrisiken und Probleme im Gesundheitswesen sein. Mit der Messung der Sterblichkeit unter 65 Jahren werden also verbreitet vorhandene Gesundheitsrisiken abgebildet.
Berechnung:
Anzahl Todesfälle von Personen unter 65 Jahren / Einwohnerzahl * 1000
Ärztliche Versorgung
Der Indikator bildet die Arztdichte ab. Die ärztliche Versorgung ist Teil einer umfassenden Gesundheitsversorgung und damit ein wichtiger Teilaspekt des Unterziels. Allgemeinärztinnen und Ärzte sind hierbei bedeutsam für die Erstversorgung und die mögliche Überweisung zu spezialisierten Medizinerinnen und Mediziner. Gleichzeitig kann die Versorgung mit Allgemeinärztinnen und Ärzte auch ein Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems insgesamt sein. Lücken in der Abdeckung können grundsätzlich auf eine ungünstige Abdeckung mit Gesundheitsdienstleistungen insgesamt hinweisen.
Berechnung:
Anzahl Allgemeinärzte, praktische Ärzte, Ärzte ohne Gebiet / Einwohnerzahl * 100 000
Wohnungsnahe Grundversorgung – Distanz zur nächsten Hausarztpraxis
Der Indikator bezeichnet die einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Hausarztpraxis. Das gewählte Vorgehen bildet die tatsächliche Entfernung zur nächsten Hausarztpraxis nur näherungsweise ab. Mittelfristig wird eine Weiterentwicklung des Indikators unter Berücksichtigung tatsächlicher Fußwegedistanzen angestrebt.
Berechnung:
Bis zum Jahr 2021: Die Luftliniendistanz beschreibt die absolute,
reliefunabhängige Distanz von einer Einwohnerzelle (250 x 250
Meter) zur nächsten Zelle mit einer Hausarztpraxis, wie verortet
durch die Adresse aus der „Wer-zu-Wem“-Firmendatenbank.
Luftlinien überschreiten hierbei keine Gewässerbarrieren, wie
zum Beispiel Flüsse. Diese Luftliniendistanz wird gemäß dem
Anteil an der Gesamtbevölkerung des Kreises oder der kreisfreien
Stadt, als Summe aller Einwohnerzellen, gewichtet.
Einwohnerzellen basieren auf dem ATKIS-Basis-DLM250
(Siedlungsflächennutzungsdaten) samt Zensusdaten von 2011
und 2022.
Ab dem Jahr 2023: Die hier ermittelte Distanz beschreibt die
absolute, reliefunabhängige Distanz im 100 x 100-Meter-Raster
entlang dem OSM-Wegenetz von einer Einwohnerzelle
(Zensus 2022) zur nächsten Zelle mit einer Hausarztpraxis,
wie verortet durch die Adresse aus dem POI-Bund-Datensatz, auf Basis der infas360-Datenbank.
Plätze in Pflegeheimen
Die Bereitstellung von Plätzen in Pflegeheimen ist ein wesentlicher Aspekt der wohnortnahen Versorgung von älteren, pflegebedürftigen Menschen. Die Bedeutung ergibt sich einerseits aus der angemessenen Versorgung der Menschen selbst, die ein stationäres Pflegeangebot benötigen. Die Verfügbarkeit von Pflegeheimplätzen führt aber auch zu einer Entlastung von Familienangehörigen, die andernfalls die Pflege selbst übernehmen müssten – mit entsprechenden Konsequenzen für die Familiensituation und Arbeitsmöglichkeiten.
Berechnung:
Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen / Einwohnerzahl im Alter ab 65 Jahren * 1000

3.9 Verringerung von Krankheit und Tod durch Chemikalien und Verschmutzung

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz
Luftqualität
Die lufthygienischen Verhältnisse sind bedeutsam für das Wohlergehen und die langfristige Gesundheit der Bevölkerung. Sie sind in Stuttgart aufgrund der topografischen Situation der städtischen Kessellage seit Beginn der Besiedlung – auch im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung – immer ein wichtiges Thema gewesen. Der gewählte Indikator greift auf zwei Grenzwerte zurück, deren Einhaltung in Stuttgart eine besondere Herausforderung darstellt. Es handelt sich um Vorsorgewerte, das heißt, eine andauernde Überschreitung der Grenzwerte macht gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen wahrscheinlicher. Es ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich, konkrete Todesfälle oder Erkrankungen kausal auf Luftverschmutzung zurückzuführen. Die Luft in Stuttgart wird seit vielen Jahren – entsprechend der gesetzlichen Regelungen – rund um die Uhr überwacht. Dazu betreibt das Land Baden-Württemberg ein entsprechendes Messnetz.
Berechnung:
Jährliche mittlere Stickstoffdioxidbelastung:
zulässig 40 μg NO2 /m³
Jährliche Anzahl von Tagen mit einem Feinstaub-
Mittelwert von PM10 > 50μg/m³: zulässig 35 Tage
Lärmbelastung
Für die Lärmkartierung 2022 wurde erstmals ein EU-weit einheitliches Verfahren eingeführt, das die Berechnung und Erfassung von Lärmbetroffenen grundlegend verändert hat. Die Menschen, die ein Gebäude bewohnen, werden in dem neuen Verfahren nicht mehr gleichmäßig auf alle Fassaden verteilt, sondern nur noch den lautesten 50 Prozent der Fassaden zugeordnet. Dadurch erhöht sich die Zahl der Personen in den höheren Lärmpegelbereichen deutlich, obwohl die tatsächliche Lärmbelastung unverändert bleibt. Die neue Methode führt zu höheren gemeldeten Werten und wird zukünftig für alle EU-Berichte verwendet. Die Daten früherer Jahre sind damit nicht direkt vergleichbar.
Berechnung:
Anzahl Betroffene mit gewichteter 24-stündiger Straßenverkehrslärmbelastung über 65 dB(A) / Einwohnerzahl * 100
Anzahl Betroffene mit nächtlicher Straßenverkehrslärmbelastung über 55 dB(A) / Einwohnerzahl * 100
SDG 4: Hochwertige Bildung
Relevante Themen des SDG 4 sind für deutsche Kommunen insbesondere der Zugang zu hochwertiger Grund- und Sekundarschulbildung, zu frühkindlicher Bildung sowie zu fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung. Im Vordergrund steht, geschlechts- und milieuspezifische Unterschiede im Bildungsbereich zu verringern sowie einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung für alle zu ermöglichen. Darüber hinaus spielen die Förderung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und der inklusiven Bildung eine wichtige Rolle.
Folgende Unterziele des SDG 4 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

4.1 Kostenlose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung
Übergang von der Grundschule
Die Übergangsquote von der Grundschule auf weiterführende Schulen gibt an, welcher Anteil der Grundschulkinder auf die verschiedenen weiterführenden Schularten wechselt. Dargestellt sind die Übergänge aus öffentlichen Grundschulen.
Berechnung:
Anzahl Übergänge auf jeweilige Schulart / Anzahl Grundschulkinder in der Abschlussklasse * 100

4.2 Gleichberechtigter Zugang zu einer hochwertigen Vorschulerziehung
Betreuungsquote von unter 3-Jährigen bzw. 3-6 Jährigen:
Der Indikator „Betreuungsquote“ bildet die tatsächliche Betreuung ab.
Berechnung:
Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren in Tageseinrichtungen / Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren * 100
Versorgungssquote von unter 3-Jährigen bzw. 3-6 Jährigen
Die Versorgungsquote mit Kindertagesbetreuung gibt den Anteil der statistisch verfügbaren Plätze für Kinder des entsprechenden Alters in Kindertageseinrichtungen inklusive der von Stuttgarter Kindern belegten Betriebsplätze an. Bei der Berechnung der Versorgungsquote wird dem Umstand Rechnung getragen, dass auch 6-jährige Kinder Kindertageseinrichtungen besuchen.
Berechnung:
Anzahl Plätze für unter 3-Jährige bzw. 3-6 Jährige / Anzahl Kinder im Alter von unter 3 Jahren bzw. 3-6 Jahren * 100
Kinder mit einer Sprachauffälligkeit:
Der Indikator beschreibt den Anteil der Kinder eines Einschulungsjahrgangs mit einem auffälligen Sprachscreening. Zur Einschätzung des Sprachentwicklungsstands wird das Heidelberger Auditive Screening in der Einschulungsuntersuchung (HASEScreening) verwendet. Dabei werden für die verschiedenen Altersgruppen entsprechende Grenzwerte angesetzt. Das HASE-Screening unterscheidet in sprachauffällige und sprachunauffällige Kinder.
Berechnung:
Anzahl Kinder mit einem auffälligen Sprachscreening nach HASE / Anzahl untersuchte Kinder eines Einschulungsjahrgangs insgesamt * 100

4.3 Gleichberechtigter Zugang zu erschwinglicher fachlicher, beruflicher und tertiärer Bildung
Schulabgänge nach Abschluss:
Der Indikator beschreibt die Anteile der Schulabgänge nach Abschluss an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen inklusive des zweiten Bildungswegs.
Berechnung:
Anzahl Schulabgänge je Abschlussart/ Anzahl Schulabgänge insgesamt * 100
Studierende:
Der Indikator beschreibt die Anzahl der Studierenden an den Hochschulen in Stuttgart jeweils für das Wintersemester eines Jahres.
Berechnung:
Anzahl Studierende pro Wintersemester

4.4 Zahl der Personen mit arbeitsmarktrelevanten Qualifikationen erhöhen
Berufliche Qualifikationen:
Dieser Indikator beschreibt den Anteil bestimmter beruflicher Qualifikationen bei den 25- bis 65-Jährigen an derselben Altersgruppe mit Berufsabschluss. Aufgrund methodischer Änderungen im Mikrozensus ist die Vergleichbarkeit für die Berichtsjahre vor und nach 2020 leicht beeinträchtigt. Dies könnte eine Erklärung für das kurze Aussetzen der Trendentwicklung in den Zeitreihen sein. Allerdings können hierfür auch Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (mit-)verantwortlich sein, wegen der es auch für das Berichtsjahr 2020 keine Daten gibt.
Berechnung:
Anzahl Personen mit akademischem Abschluss bzw.
mit Lehre/Berufsausbildung oder
Fachschulabschluss (25–65 Jahre) / Anzahl Personen mit beruflichem Bildungsabschluss
(25–65 Jahre) * 100

4.5 Beseitigung jeglicher Diskriminierung im Bildungswesen
Ganztagsgrundschulen:
Der Indikator beschreibt den Anteil der Ganztagsgrundschulen an allen öffentlichen Stuttgarter Grundschulen. Ganztagsgrundschulen stellen kostenlos umfassende Bildungsangebote sicher, da sie die Möglichkeit bieten, Lern- und Ruhezeiten über den Tag zu verteilen und den Unterricht durch Bildungsangebote aus verschiedenen Themen- und Interessenbereichen zu ergänzen (z. B. musische, sportliche oder kulturelle Bildungsangebote).
Berechnung:
Anzahl öffentliche Ganztagsgrundschulen / Anzahl Grundschulen insgesamt * 100
Inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler (Sus):
Der Indikator beschreibt den Anteil inklusiv beschulter Schülerinnen und Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch an einer öffentlichen Stuttgarter Schule für die jeweilige Schulart.
Berechnung:
Anzahl inklusiv beschulter Schülerinnen und Schüler je Schulart/ Anzahl aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch * 100
Digitalisierung an städtischen Schulen:
Der Indikator beschreibt den Anteil der Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen, denen ein digitales Endgerät zur Verfügung steht.
Berechnung:
Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen mit digitalen Endgeräten/ Anzahl Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen insgesamt * 100

4.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Weltbürgerschaft (global citizenship)
Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Die dem Indikator zugrunde liegende Statistik resultiert aus einer erstmaligen ämterübergreifenden Abfrage zur Nutzung von 15 kommunal geförderten oder durchgeführten Angeboten der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Zeitraum von 2010 bis 2023. Diese BNE-Angebote werden von fünf Ämtern, neun Abteilungen und zwei Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Stuttgart umgesetzt. Der Indikator beschreibt, die Anzahl der Teilnahmen von Vorschulkindern sowie Schülerinnen und Schülern (von Grundschulen, weiterführenden Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)) an den 15 berücksichtigten Bildungsangeboten und Förderungen. Darunter befinden sich BNE-Angebote, die mit den Gruppen einmalig oder je nach Angebotsformat auch mehrfach umgesetzt wedren.
Berechnung:
Jährliche Anzahl der Teilnahme von Vorschulkindern,
Schülerinnen und Schülern (Grund-, weiterführende
Schulen und SBBZ) an BNE-Angeboten, welche
kommunal gefördert bzw. angeboten wurden / Jährliche Gesamtzahl Vorschulkinder,
Schülerinnen und Schüler
(an Grund-, weiterführende Schulen und SBBZ) * 100
Medienbestand der Stadtbibliothek
Der Indikator beschreibt die Anzahl der Bücher und Medien pro Einwohnerin und Einwohner in der Stuttgarter Stadtbibliothek einschließlich der Zweigstellen und Fahrbüchereien. Seit 2015 enthalten die Werte auch die digitalen Angebote.
Berechnung:
Anzahl Medien / Einwohnerzahl * 100
Kulturhaushalt
Der Kulturhaushalt umfasst die Aufwendungen des Kulturamts und weiterer städtischer Ämter im Bereich Kultur. Diese werden auf die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bezogen und geben an, wie viele Mittel im städtischen Haushalt für Kultur zur Verfügung stehen. Bis einschließlich 2021 sind Rechnungsergebnisse vermerkt, für das Jahr 2022 der Haushaltsansatz, da die Rechnungsergebnisse noch nicht vorlagen.
Berechnung:
Kulturetat in Euro / Einwohnerzahl
SDG 5: Geschlechtergleichheit
Relevante Themen des SDG 5 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen sowie der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, die Anerkennung unbezahlter Pflege- und Hausarbeit, die Sicherstellung der Teilhabe von Frauen durch die Übernahme von Führungsrollen, die Sicherstellung des Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und allgemein die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.
Folgende Unterziele des SDG 5 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

5.1 Beendigung der Diskriminierung von Frauen und Mädchen
Verhältnis der Beschäftigungsquoten
Der Wert des Indikators gibt die Beschäftigungsquote von Frauen relativ zu der von Männern an. Ein Wert von 100 steht für gleiche Beschäftigungsquoten bei Frauen und Männern. Werte unter 100 zeigen eine geringere Beschäftigungsquote der Frauen im Vergleich zur der von Männern an. Damit berücksichtigt der Indikator die Beschäftigungssituation insgesamt. Unberücksichtigt bleiben dagegen die Qualität der Beschäftigung (vgl. dazu die folgenden Indikatoren) und die Frage, in welchem Ausmaß ein freiwilliger Verzicht auf Beschäftigung verantwortlich ist für die Unterschiede.
Berechnung:
(Anzahl SvB Frauen am Wohnort / Anzahl Frauen insgesamt * 100) / (Anzahl SvB Männer am Wohnort / Anzahl Männer insgesamt * 100) * 100
Relative Frauenarmut
Der Indikator „Relative Frauenarmut“ gibt an, wie hoch der Anteil der Frauen, die Leistungen nach SGB II bzw. SGB XII beziehen, im Vergleich zum Anteil der Männer mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII ist. Der Indikator nimmt den Wert 100 an, wenn der Anteil von Frauen mit Bezug dieser Leistungen unter allen Frauen exakt genauso hoch ist wie der Anteil von Männern mit diesem Leistungsbezug unter allen Männern. Ein Wert über 100 zeigt eine höhere Quote von Frauen mit Leistungsbezug nach SGB II bzw. SGB XII im Vergleich zu dieser Quote der Männer an, also eine stärkere Armutsbetroffenheit bei Frauen als bei Männern. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 31. Dezember.
Berechnung:
(Anzahl leistungsberechtigte Frauen
nach SGB II und SGB XII / Anzahl Frauen ab 15 Jahren insgesamt) / (Anzahl leistungsberechtigte Männer
nach SGB II und SGB XII / Anzahl Männer ab 15 Jahren insgesamt) * 100
Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern
Der Indikator setzt das Medianeinkommen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) vollzeitbeschäftigter Frauen ins Verhältnis zum Medianeinkommen vollzeitbeschäftigter Männer und zeigt damit den unbereinigten geschlechtsspezifischen Verdienstabstand. Damit werden die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern auf kommunaler Ebene sichtbar. Zum einen sind die Einkommensunterschiede auf die Berufswahl und die Berufserfahrung zurückzuführen, welche im unbereinigten GPG enthalten sind. Darüber hinaus wirkt sich eine familienbedingte vorübergehende Unterbrechung der Erwerbstätigkeit ebenfalls negativ auf die Höhe des Medianeinkommens aus. Außerdem ist zu beachten, dass bei der Berechnung des Indikators nur Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt werden. Da jedoch 40 Prozent der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt sind, ist davon auszugehen, dass der GPG noch höher ausfallen würde, wenn auch diese in die Berechnung einbezogen würden.
Berechnung:
Medianeinkommen svB Frauen in Vollzeit / Medianeinkommen svB Männer in Vollzeit * 100

5.4 Wertschätzung unbezahlter Sorgearbeit und Förderung geteilter häuslicher Verantwortlichkeiten
Väterbeteiligung am Elterngeld
Der Indikator gibt die Beteiligung der Väter am Elterngeld im Verhältnis zu allen Leistungsbeziehenden an. Die Väterbeteiligung ist ein wichtiger Indikator, um abzuschätzen, in welchem Umfang sich Väter an der Betreuung ihrer Kinder beteiligen und ob bzw. inwieweit diese Beteiligung im Laufe der Zeit zunimmt. Dieser Indikator wurde erstmals im Jahr 2023 eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden.
Berechnung:
Anzahl Väter mit Elterngeldbezug / Anzahl Personen mit Elterngeldbezug insgesamt * 100

5.5 Umfassende Teilhabe bei der Übernahme von Führungsrollen und bei der Entscheidungsfindung
Frauen im Stuttgarter Gemeinderat
Der Frauenanteil im Stuttgarter Gemeinderat zeigt die Repräsentation von Frauen in der kommunalen Politik. Gerade an repräsentierende Organe wird die Erwartung gerichtet, in ihrer Zusammensetzung tendenziell der Bevölkerungszusammensetzung zu entsprechen. Der Frauenanteil ist dabei ein wichtiger Aspekt unter mehreren, der in dem Nachhaltigkeitsunterziel direkt angesprochen wird. Der Frauenanteil im Gemeinderat wird von zwei Faktoren bestimmt: der Aufstellung der Kandidierenden durch Parteien und Listenzusammenschlüsse einerseits und der Wahlentscheidung andererseits.
Berechnung:
Anzahl Frauen mit Sitz im Gemeinderat / Sitze im Gemeinderat insgesamt * 100
Anzahl Bewerberinnen bei Gemeinderatswahlen / Bewerberinnen und Bewerber insgesamt * 100
Frauen in Führungspositionen
Der Indikator beschreibt den Anteil der Führungspositionen in der Kernverwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart (ohne Klinikum), die mit Frauen besetzt sind. Die Werte geben an, inwieweit ein paritätisches Geschlechterverhältnis vorliegt.
Berechnung:
Anzahl Frauen in städtischen Führungspositionen / Anzahl Mitarbeitende in städtischen
Führungspositionen insgesamt * 100
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 6 sind insbesondere die Verbesserung der Wasserqualität, die Umsetzung eines integrierten Wassermanagements und der Schutz oder die Wiederherstellung wasserbezogener Ökosysteme, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, die effiziente Wassernutzung in allen Sektoren sowie die Unterstützung von Entwicklungsländern beim Kapazitätsaufbau im Bereich der Wasser- und Sanitärversorgung und die Beteiligung lokaler Gemeinschaften im Rahmen von Partnerschaften im Globalen Süden.
Folgende Unterziele des SDG 6 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

6.2 Zugang zu sanitären Einrichtungen für alle
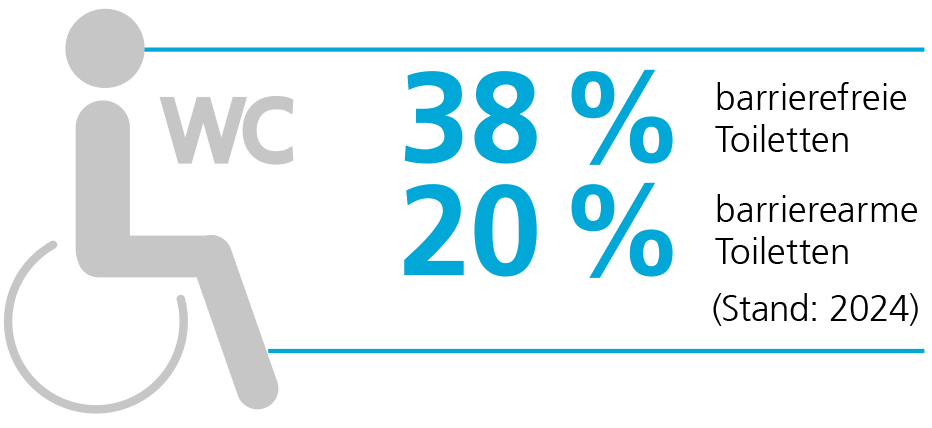
Barrierefreie oder -arme Sanitäranlagen
Der Indikator gibt den Anteil der barrierefreien und barrierearmen Sanitäranlagen in Stuttgart in Relation zu allen öffentlichen Sanitäranlagen an.
Berechnung:
Anzahl barrierefreie bzw. -arme öffentliche Sanitäranlagen / Anzahl öffentliche Sanitäranlagen insgesamt * 100

6.3 Verbesserung der Wasserqualität, Abwasserbehandlung und gefahrlose Wiederverwendung
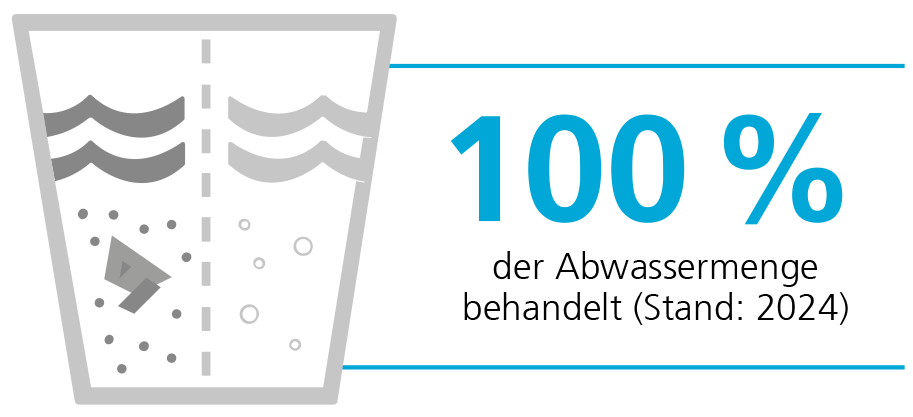
Abwasserbehandlung
Abwasser bezeichnet durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigtes Wasser. Eine mangelhafte Abwasserreinigung kann dazu führen, dass schädliche Inhaltsstoffe in Gewässer eingeleitet werden und deren Nährstoffgehalt signifikant erhöhen. Dieser Überschuss an Nährstoffen wird von Bakterien abgebaut. Dabei wird Sauerstoff verbraucht, was zu Fischsterben und einem erhöhten Algenwachstum führt. Um die gefahrlose Nutzung von Gewässern und eine nachhaltige Wiedereinführung von Abwasser in die Gewässer gewährleisten zu können, müssen die Kommunen dieses angemessen behandeln.
Berechnung:
Abwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird / Abwassermenge insgesamt * 100

6.4 Steigerung der Wassernutzungseffizienz und Sicherung der Süßwasserversorgung
Trinkwasserverbrauch
Der Verbrauch von Trinkwasser hängt sowohl vom privaten Verbrauch als auch von der Wassernutzung durch Wirtschaftsbetriebe ab. Während der Trinkwasserverbrauch der Industrie separat erhoben wird, ist eine Trennung zwischen Privathaushalten und Kleingewerbe nicht möglich. Der Wert wird zwar alle drei Jahre ermittelt, doch stehen die Daten erst einige Zeit nach der Erfassung des Trinkwasserverbrauchs zur Verfügung. Der Indikator bildet den durchschnittlichen täglichen Trinkwasserverbrauch durch Privathaushalte und Kleingewerbe pro Einwohnerin und Einwohner ab.
Berechnung:
(Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Privathaushalte und Kleingewerbe) / Einwohnerzahl) * Tage pro Jahr

6.6 Schutz und Wiederherstellung von wasserverbundenen Ökosystemen

Fließwasserqualität
Das im Gewässer bestimmbare Makrozoobenthos (kleine wirbellose Wasserbewohner, wie Köcherfliegenlarven, Asseln, Schnecken etc.) lässt Rückschlüsse auf die Belastung eines Gewässers durch Abwassereinleitungen und ihre sauerstoffzehrende Wirkung zu. Anhand der gefundenen Arten und ihrer gewichteten Zusammensetzung wird der Saprobienindex bestimmt und einer Gewässergüteklasse zugeordnet. Das Vorgehen ist in der DIN-Norm 38410 festgelegt. Der Indikator für Fließwasserqualität gibt den Anteil von Gewässerkilometern an, die mindestens in der Güteklasse II liegen.
Berechnung:
Fließgewässer mit mindestens Güteklasse II in km / Fließgewässer insgesamt in km * 100
SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie
Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 7 sind insbesondere der allgemeine Zugang zu bezahlbaren, zuverlässigen und modernen Energiedienstleistungen sowie die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix, die Steigerung der Energieeffizienz, die internationale Zusammenarbeit im Bereich sauberer Energien und der Ausbau der Infrastruktur.
Folgende Unterziele des SDG 7 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

7.2 Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am globalen Energiemix
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch
Erfasst wird der gesamte Strom- und Wärmeverbrauch aus erneuerbaren Energien. Das heißt, neben der erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung im Stadtgebiet werden der Bezug von Ökostrom, der erneuerbare Anteil am bundesdeutschen Strommix, die Beteiligungen der Stadtwerke Stuttgart an regenerativen Erzeugungsanlagen sowie der erneuerbare Anteil an der Fernwärme berücksichtigt. Des Weiteren wird der Anteil der regenerativen Kraftstoffe im Verkehr auf der Stuttgarter Gemarkung berücksichtigt.
Berechnung:
Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien / Brutto-Endenergieverbrauch (klimabereinigt) * 100
Strom aus Photovoltaik
Der Indikator beschreibt die durchschnittlich pro Kopf installierte Leistung der Photovoltaikanlagen in Stuttgart, wobei die installierte Leistung angibt, wie viel Strom diese Anlagen theoretisch produzieren könnten.
Berechnung:
Installierte Photovoltaikleistung / Einwohnerzahl
Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet
Der Indikator „Produktion erneuerbarer Energie im Stadtgebiet“ bildet die lokale, nachhaltige Energieversorgung ab und berücksichtigt dabei sowohl die Strom- als auch die Wärmeerzeugung.
Berechnung:
Jährliche Wärme- und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Stadtgebiet (GWh/a)

7.3 Verdoppelung der Steigerungsrate der Energieeffizienz
Energieverbrauch
Der Indikator Endenergieverbrauch zeigt, in welchem Umfang tatsächlich Energie verbraucht wird. Er wird zum einen als Summe für die Gesamtstadt angegeben. Zum anderen wird, differenziert nach den Sektoren Gewerbe/Handel/Dienstleistung und Industrie, Verkehr sowie private Haushalte, die spezifische Entwicklung des Energieverbrauchs dargestellt. Der Indikator setzt den Endenergieverbrauch jeweils ins Verhältnis zu der Nutzerzahl. Im Fall des Endenergieverbrauchs in Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie ist dies die Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB), im Fall von Verkehr und privaten Haushalten ist es die Einwohnerzahl.
Berechnung:
Endenergieverbrauch Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie:
Verbrauch Endenergie Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie (klimabereinigt) / Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Endenergieverbrauch Verkehr:
Verbrauch Endenergie Verkehr (klimabereinigt) / Einwohnerzahl
Endenergieverbrauch private Haushalte:
Verbrauch Endenergie private Haushalte (klimabereinigt) / Einwohnerzahl
Endenergieverbrauch Gesamtstadt:
Verbrauch Endenergie Gesamtstadt (klimabereinigt)
Energieproduktivität
Die Energieproduktivität setzt den Energieverbrauch ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Produktivität. So wird deutlich, in welchem Maß Energie effizient genutzt wird. Damit ergänzt der Indikator die Indikatoren zu Energieerzeugung und Energieverbrauch um eine Messung der Effizienz ihrer Nutzung.
Berechnung:
Bruttoinlandsprodukt / Endenergieverbrauch Gesamtstadt

7.a.1 Förderung des Zugangs zu Forschung und Technologie sowie Investitionen in saubere Energie und Infrastruktur
Ladesäuleninfrastruktur
Der Indikator die Anzahl der öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunkte in Stuttgart pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner. Alle Datenauswertungen basieren auf den Angaben der Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 5 Ladesäulenverordnung. Bei der Bundesnetzagentur meldepflichtig sind alle öffentlich zugänglichen Ladepunkte mit über 3,7 kW Ladeleistung, die seit dem Inkrafttreten der Verordnung am 17. März 2016 in Betrieb genommen wurden. Schnellladepunkte mit mehr als 22 kW Ladeleistung sind vollständig erfasst. Angaben zu älteren Normalladepunkte und Ladepunkten bis 3,7 kW Ladeleistung basieren auf freiwilligen Meldungen der Betreiber. Die Daten zur Anzahl der Ladepunkte stellen den Bestand zum 1. Januar des jeweiligen Jahres dar.
Berechnung:
Anzahl öffentliche Normal- und
Schnellladepunkte ab 3,7 kW/ Einwohnerzahl * 1000
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Relevante Themen des SDG 8 für deutsche Kommunen sind ein angemessenes Wirtschaftswachstum sowie die Steigerung von Produktivität und Ressourceneffizienz. Darüber hinaus geht es bei SDG 8 auch um die Erreichung von Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verringerung des Anteils junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder Berufsausbildung haben.
Folgende Unterziele des SDG 8 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

8.1 Zukunftsfähiges Wirtschaftswachstum
Bruttoinlandsprodukt
Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller innerhalb einer räumlichen Einheit als Endprodukte produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich der Vorleistungen in jeweiligen Preisen. Für den Indikator wird das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis zur amtlichen Bevölkerungszahl gesetzt.
Berechnung:
Bruttoinlandsprodukt / Einwohnerzahl

8.5 Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle bei gleichwertigem Entgelt
Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosenquote bezieht die Zahl der registrierten Arbeitslosen auf alle zivilen Erwerbspersonen (d. h. Erwerbstätige + registrierte Arbeitslose). Zu den zivilen Erwerbspersonen zählen alle abhängigen zivilen Erwerbspersonen sowie die Selbständigen und die mithelfenden Familienangehörigen. Die abhängigen zivilen Erwerbspersonen setzen sich zusammen aus sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (einschließlich der Auszubildenden), geringfügig Beschäftigten, Personen in Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandvariante), zivilen Beamten (ohne Soldaten), Grenzpendlern sowie registrierten Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote erfasst nur Personen, die sich selbst arbeitslos melden. Personen, die nicht erwerbstätig sind und eigentlich gerne eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden, sich aber nicht bei der Agentur für Arbeit melden, werden daher nicht erfasst. Insbesondere Personen, die nicht zum Bezug von Arbeitslosengeld (I) berechtigt sind, haben wenig Anreiz, sich arbeitslos zu melden. So kommt es zu einer Untererfassung von registrierten Arbeitslosen. Dies gilt insbesondere für Berufsrückkehrende, die nach einer Phase der Nicht-Erwerbstätigkeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, aber gern wieder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen würden. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Untererfassung von Arbeitslosigkeit Frauen stärker betrifft als Männer.
Berechnung Arbeitslosigkeit gesamt:
Registrierte Arbeitslose / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose)*100
Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 Jahren wird berechnet, indem die Anzahl der registrierten Arbeitslosen unter 25 Jahren ins Verhältnis gesetzt wird zur Summe aus allen zivilen Erwerbstätigen unter 25 Jahren und den registrierten Arbeitslosen unter 25 Jahren.
Berechnung Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen:
Registrierte Arbeitslose unter 25 Jahren / (Zivile Erwerbstätige unter 25 Jahren insgesamt
+
Registrierte Arbeitslose unter 25 Jahren)*100
Langzeitarbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen besonders problematisch, wenn sie über lange Zeit anhält. Langzeitarbeitslose sind Menschen, die durchgehend länger als ein Jahr arbeitslos sind. Analog zur Definition von Arbeitslosigkeit werden bei der Langzeitarbeitslosenquote die Langzeitarbeitslosen ins Verhältnis gesetzt zu den zivilen Erwerbstätigen und den registrierten Arbeitslosen.
Berechnung:
Registrierte Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose)*100
Beschäftigungsquote
Die Beschäftigungsquote ist definiert als die Relation von Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) zur Bevölkerung im Erwerbsalter. Damit bezieht sich die Beschäftigungsquote ausschließlich auf abhängig Beschäftigte, nicht jedoch auf Selbständige oder mithelfende Familienangehörige. Auch Beamtinnen und Beamte werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Anteil der Menschen, die außerhalb des Haushalts arbeiten, wird folglich systematisch unterschätzt. Allerdings sind die Veränderungen in diesem Arbeitssegment von großer Bedeutung und eine wichtige Ergänzung zum Indikator Arbeitslosigkeit. Die Werte geben den Stand jeweils zum Stichtag 30. Juni wieder.
Berechnung:
Anzahl svB am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren / Einwohnerzahl (15 - 64 Jahre)*100
„Erwerbsaufstockende“
Nicht jede Beschäftigung führt zu ausreichend Einkommen. Menschen mit niedrigem Einkommen haben die Möglichkeit eine Grundsicherung für Arbeitsuchende (derzeit Bürgergeld, zuvor Arbeitslosengeld II) zu erhalten. Diese sogenannten Erwerbsaufstockenden sind also sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt oder selbständig und erhalten zusätzlich staatliche Unterstützung. Der Indikator „Erwerbsaufstockende“ setzt die erwerbstätigen Bürgergeld-Berechtigten ins Verhältnis zur Gesamtzahl derer, die Bürgergeld beziehen. Er zeigt an, welcher Anteil derer, die Leistungen beziehen, in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, geringfügig beschäftigt oder selbständig ist. Dies gibt Hinweise auf die Größe des Niedriglohnsektors, zeigt aber auch an, welcher Anteil der Bürgergeld-Beziehenden zumindest in den sozialen Kontext einer – wenn auch schlecht bezahlten – Arbeitsstelle eingebunden ist. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 31. Dezember, nur im Jahr 2024 bezogen sich die Daten auf den 1. Juni.
Berechnung:
Anzahl erwerbstätige Bürgergeld-Beziehende / Anzahl erwerbsfähige Bürgergeld-Beziehende insgesamt)*100
Geringfügige Beschäftigung
Der Indikator gibt den Anteil der ausschließlich geringfügig Beschäftigten an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (svB) zuzüglich der ausschließlich geringfügig Beschäftigten an. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt insgesamt die sogenannte Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. Die Geringfügigkeitsgrenze, die die Höhe des Arbeitsentgelts für eine geringfügige Beschäftigung festlegt, ist flexibel ausgestaltet und steigt parallel zum Mindestlohn. Damit wird dauerhaft sichergestellt, dass bei einer Beschäftigung von nicht mehr als zehn Stunden pro Woche zum Mindestlohn ein sogenannter Minijob vorliegt. Stichtag für die Datenerhebung ist jeweils der 30. Juni.
Berechnung:
Anzahl ausschließlich geringfügig Beschäftigte / (Anzahl svB + ausschließlich geringfügig Beschäftigte)*100

8.8 Schutz der Arbeitnehmerrechte und Förderung eines sicheren Arbeitsumfeldes
Arbeitssicherheit
Dieser im Jahr 2025 eingeführte Indikator stellt die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle der Mitglieder der DGUV dar. Enthalten sind Mitglieder der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, das heißt auch Angestellte aus dem öffentlichen Dienst (ohne Beamte). Dies umfasst Versicherungskreise, die „typischerweise“ mit dem Arbeitsunfallgeschehen in Zusammenhang stehen: Insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer, abhängig Beschäftigte und mitarbeitende Familienangehörige. Nicht enthalten sind dagegen die Versicherten bei der SVLFG (Landwirtschaft, Forst und Gartenbau) und weitere Personenkreise, wie Blutspendende, ehrenamtlich Tätige, Schülerinnen und Schüler, Strafgefangene, Rehabilitanden und weitere. Da hier somit lediglich eine Teilmenge aller Versicherten abgebildet wird, ist anzunehmen, dass die Gesamtzahl an Arbeitsunfällen noch etwas höher ist, als hier dargestellt – der übergeordnete Trend wird durch die Daten jedoch gut abgebildet. Da der Unfallort erst seit 2017 im Rahmen der Unfallanzeigen erhoben wird, beginnt die oben dargestellte Zeitreihe auch erst im Jahr 2017.
Berechnung:
Anzahl meldepflichtige Arbeitsunfälle / Einwohnerzahl (15-64 Jahre) *100

8.9 Förderung eines positiven und nachhaltigen Tourismus“
Beherbergungsplätze
Dieser im Jahr 2025 eingeführte Indikator stellt die Anzahl (jährlicher Durchschnitt) der von Stuttgarter Beherbergungsbetrieben angebotenen Schlafgelegenheiten dar. Hierbei werden Einrichtungen für die vorübergehende Beherbergung (unter zwei Monaten) von Gästen mit zehn und mehr Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen erfasst. Kleinbetriebe mit weniger Betten oder Stellplätzen sowie Ferienwohnungen und privat vermietete Zimmer (z. B. über Airbnb) sind nicht enthalten.
Berechnung:
Anzahl angebotene Schlafgelegenheiten
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 9 sind insbesondere der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur, die Modernisierung aller Industrien und Infrastrukturen, der Ausbau der Forschung und die Verbesserung industrieller Technologien, die internationale Zusammenarbeit zur nachhaltigen Infrastrukturentwicklung, die Unterstützung der Entwicklung einheimischer Technologien und der industriellen Diversifizierung sowie die Förderung des allgemeinen Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien.
Folgende Unterziele des SDG 9 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

9.5 Verbesserung der Forschung sowie Ausbau der industriellen Technologien und Förderung von Innovationen
Existenzgründungen
Der Indikator Existenzgründungen bildet die Häufigkeit der Neuerrichtung von Gewerbebetrieben relativ zur Bevölkerungszahl ab. Es handelt sich um eine treffende, allerdings recht grobe Beschreibung des Phänomens, denn in den Indikator gehen Neugründungen von innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial genauso ein wie Kleingewerbetreibende, beispielsweise ein neuer Friseursalon oder ein Imbiss.
Berechnung:
Anzahl Gewerbe-Neugründungen / Einwohnerzahl*1000
Gründungsintensität
Der Indikator Gründungsintensität gibt die Anzahl der Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz an. Eine Haupt- und Zweigniederlassungsgründung wird dann als Betriebsgründung mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gewertet, wenn der Betrieb ins Handelsregister eingetragen ist oder mindestens eine Person in der Betriebsstätte im Haupterwerb beschäftigt ist. Insgesamt wurden die Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz in der Landeshauptstadt Stuttgart in 19 Wirtschaftsabschnitte unterteilt, um die Betriebe nach ihren Tätigkeiten zuzuordnen.
Berechnung:
Anzahl Betriebsgründungen mit wirtschaftlicher Substanz / Einwohnerzahl*1000
Hochqualifizierte
Der Indikator Hochqualifizierte gibt den Anteil von Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an.
Berechnung:
Anzahl SvB mit akademischem Berufsabschluss am Arbeitsort / Anzahl SvB am Arbeitsort insgesamt*100
Innovationsindex
Der Innovationsindex verfolgt den Zweck, die Innovationsfähigkeit und das Innovationspotenzial auch auf der Ebene verschiedener Wirtschaftsräume vergleichbarer zu machen. Dieser Indikator fasst mehrere Innovationsindikatoren zusammen, damit es eine einzelne für Vergleiche und zur Darstellung geeignete Kennzahl gibt. Der Indikator wurde im Jahr 2023 neu eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden. Der Wertebereich des Innovationsindex reicht von 0 bis 100 und wird in Indexpunkten ausgedrückt. Sobald der Indikator 40 Punkte erreicht, wird die Innovationsfähigkeit als hoch eingestuft und gehört damit zur Spitzengruppe. Bei einem Indexwert von unter 20 Punkten wird das Land, der Kreis, die Region oder die Stadt der Schlussgruppe zugeordnet.
Berechnung:
Der Index berechnet sich aus den Werten sechs standardisierter Einzelindikatoren
Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft
Der Indikator wurde im Jahr 2023 neu eingeführt und soll künftig fortgeschrieben werden. Er stellt Anzahl des Personals dar, welche im Bereich Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft eingesetzt wurden. Das Personal, das in der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung tätig ist, wird in Vollzeitäquivalenten angegeben und auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bezogen.
Berechnung:
FuE-Personal im Wirtschaftssektor Stuttgart / Anzahl SvB*100

9.c Universeller Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie
Breitbandversorgung der privaten Haushalte
Die Breitbandversorgung privater Haushalte gibt an, wie hoch der Anteil der privaten Haushalte ist, der mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 Mbit/s an das Breitbandnetz angeschlossen ist. Der Stichtag für die Datenaktualisierung ist im Dezember eines jeden Jahres, mit Ausnahme des Jahres 2021, als die Daten bereits im Juli aktualisiert wurden. Dieser Indikator wurde im Jahr 2023 um Informationen zur Glasfaserversorgung ergänzt. Die Daten hierzu, die auf freiwilliger Basis über den Anbieter zur Verfügung gestellt werden und daher unvollständig sein können, werden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert.
Berechnung:
(Anzahl Haushalte mit Breitbandversorgung mehr als 50 Mbit/s / Anzahl Haushalte insgesamt) *100
(Anzahl Haushalte mit Glasfaserversorgung FFTB/H mit 1000 Mbit/s oder mehr / Anzahl aller Haushalte) *100
SDG 10: Weniger Ungleichheiten
Relevante Themen des SDG 10 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Befähigung aller Menschen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Ethnizität, Herkunft, Religion, wirtschaftlichem oder sonstigem Status – zur Selbstbestimmung sowie die Förderung ihrer Inklusion. Darüber hinaus geht es um die Gewährleistung von Chancengleichheit sowie insbesondere auch um Fragen der Migration und Integration.
Folgende Unterziele des SDG 10 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

10.2 Förderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion aller Menschen
Relative Armutsquote bei Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern ohne deutsche Staatsbürgerschaft
Der Indikator setzt den Anteil der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die Leistungen nach SGB II (Regelleistungsberechtigte), SGB XII (Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und von Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen sowie nach AsylbLG) beziehen, ins Verhältnis zum entsprechenden Anteil der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Weil die Armutsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Vergleich zur Armutsquote bei Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft deutlich höher ist, wird die relative Armutsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft nicht in Prozent ausgedrückt, sondern im Vielfachen der Armutsquote bei Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Bei gleich hohen Armutsquoten von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft würde der Indikator den Wert 1 annehmen. Werte über 1 zeigen an, um wie viel Mal höher die Armutsquote der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Vergleich zu der von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist.
Berechnung:
((Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII
ohne deutsche Staatsangehörigkeit + Anzahl Leistungsbeziehende nach AsylbLG) / Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit insgesamt) / (Anzahl Leistungsberechtigte nach SGB II und SGB XII
mit deutscher Staatsangehörigkeit / Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit insgesamt)
Relative Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft
Die relative Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gibt an, wie hoch die Beschäftigungsquote von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Verhältnis zu der von allen Beschäftigten ist. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet also, dass die Beschäftigungsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft geringer ist als bei allen Beschäftigten, während ein Wert über 100 Prozent für eine höhere Beschäftigungsquote bei Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft steht. Zukünftig sollte bei diesem Indikator eine Anpassung der Regelaltersgrenze vorgenommen werden, da immer mehr Menschen erst mit über 65 Jahren in Rente gehen.
Berechnung:
(Anzahl ausländische SvB am Wohnort (15 bis 64 Jahre) / Anzahl Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (15 bis 64 Jahre) insgesamt) / (Anzahl SvB am Wohnort (15 bis 64 Jahre) insgesamt / Einwohnerzahl (15 bis 64 Jahre) insgesamt)*100
Verhältnis des Medianentgelts nach Staatsbürgerschaft
Das Medianentgelt beschreibt das mittlere Entgelt aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten. Bei diesem Indikator wird das mittlere Entgelt von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ins Verhältnis zum mittleren Entgelt der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesetzt. Bei einem Vergleich der Entgelte würde ein Wert von 100 Prozent bedeuten, dass das Medianentgelt der Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft gleich hoch ist wie das der Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Indikator berücksichtigt ausschließlich Vollzeitbeschäftigte. Die Daten stammen von der Bundesagentur für Arbeit aus den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung. Da Löhne und Gehälter für die Rentenversicherung nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze gemeldet werden, ist nicht für alle Beschäftigten das tatsächlich erzielte Entgelt bekannt. Die Daten werden jeweils zum 31. Dezember erhoben.
Berechnung:
Medianentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter ohne deutsche Staatsbürgerschaft / Medianentgelt sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter
mit deutscher Staatsbügerschaft)*100
Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger
Als Treffpunkte für Bürgerinnen und Bürger sind hier Begegnungsstätten für Ältere, Stadtteil- und Familienzentren sowie Stadtteilhäuser zusammengefasst, die ins Verhältnis zur Einwohnerzahl insgesamt gesetzt werden. Bürgerhäuser sind in dieser Aufzählung nicht enthalten.
Berechnung:
Anzahl Begegnungsstätten für Ältere, Stadtteilhäuser, Stadtteil- und Familienzentren / Einwohnerzahl * 100 000
Barrierearme Wohnungen
Für die Zwecke dieses Indikators wird eine barrierearme Wohnung als eine Wohnung definiert, die folgende Kriterien erfüllt: (a) Die Wohnung ist vom Gehweg aus stufenlos erreichbar, (b) die Türen haben eine Mindestbreite von 80 cm, (c) die Wohnung verfügt über eine bodengleiche (schwellenlose) Dusche oder Badewanne mit Türeinstieg, (d) der Wandabstand (z. B. auch im Flur) beträgt mindestens 1,20 m, (e) im Sanitärbereich existiert ein potenziell ausreichender Wendekreis für einen Rollstuhl (ca. 1,50 m Durchmesser) und (f) der Küchenbereich hat einen potenziell ausreichenden Wendekreis für einen Rollstuhl (ca. 1,50 m Durchmesser) und (g) die Wohnung liegt auf einer Ebene. Die Kriterien und die auf ihrer Basis erhobenen Daten stammen aus der Wohnungsmarktbefragung im Jahr 2020 welche alle zwei Jahre von der Landeshauptstadt Stuttgart durchgeführt wird.
Berechnung:
Anzahl barrierearme Wohnungen in Stuttgart / Anzahl Privathaushalte insgesamt *100

10.4 Eine Steuer- und Sozialpolitik, die Gleichheit fördert
Einkommensverteilung (niedrig, mittel, hoch)
Die Berechnung des Indikators hat sich gegenüber den früheren Berichten geändert. Die Einkommensverteilung wird ab der dritten Bestandsaufnahme anhand des Äquivalenzeinkommens in drei Einkommensklassen (niedrig, mittel, hoch) dargestellt. Die Berechnungsgrundlage des Äquivalenzeinkommens ist beim Indikator „Armutsgefährdungsquote“ beschrieben (vgl. SDG 1).
Berechnung:
Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen von unter 60 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100
Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen von 60 bis 150 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100
Anzahl Haushalte mit einem Äquivalenzeinkommen über 150 Prozent / Anzahl Haushalte insgesamt *100
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
Relevante Themen des SDG 11 für deutsche Kommunen sind insbesondere der Zugang zu Wohnraum und Grundversorgung, nachhaltige Verkehrssysteme, nachhaltige Stadtplanung, der Katastrophenschutz, die Senkung der Umweltbelastung und der Zugang zu Grünflächen.
Folgende Unterziele des SDG 11 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

11.1 Sicherer und bezahlbarer Wohnraum
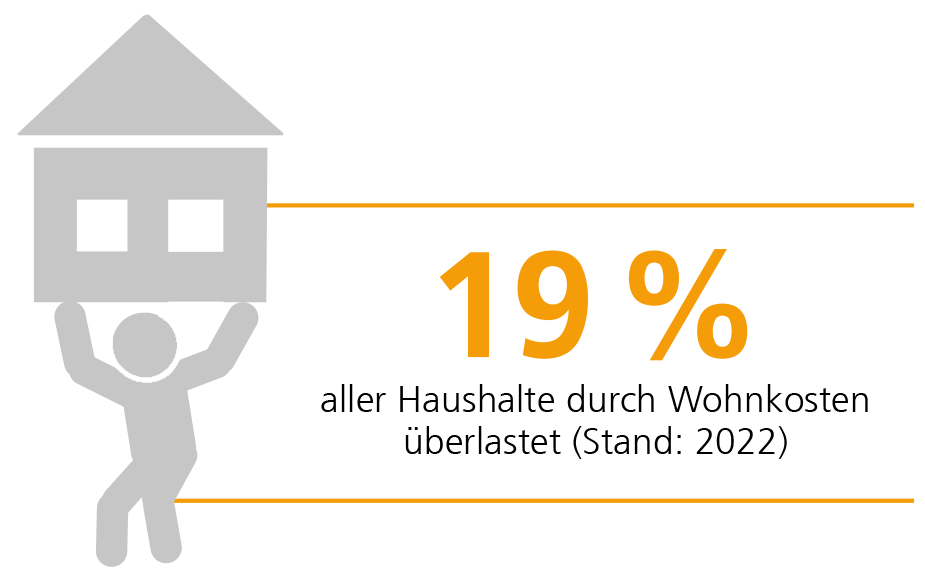
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
Angebotsmietpreise
Der durchschnittliche Mietpreis informiert über den Mietpreis von online inserierten Wohnungen nach Größe mit dem arithmetischen Mittel der Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Der Indikator gibt die Mietpreisentwicklung als Gesamtdurchschnitt an. Dabei kann nicht berücksichtigt werden, dass der Quadratmeterpreis nach Beschaffenheit und Lage der Wohnung variiert. Zudem gehen die Mietpreise von Wohnungen, die nicht online inseriert werden, nicht in die Betrachtung ein.
Berechnung:
Angebotsmieten in Euro (nettokalt) je m² für Erst- und Wiedervermietung
Finanzielle Belastung durch Wohnkosten
Dieser Indikator wurde 2025 eingeführt. Er bezieht sich auf den Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen. Im Allgemeinen werden Mieten bis 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens als noch angemessen angesehen. Nach EU-Definition sind Haushalte von einer finanziellen Überbelastung betroffen, wenn sie mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen.
Berechnung:
Anzahl Haushalte mit Bruttokaltmiete
(Grundmiete und „kalte“ Betriebskosten)
> 40 % des Haushaltsnettoeinkommens / Anzahl Miethaushalte insgesamt *100
Anteil Sozialmietwohnungen am Gesamtmietwohnungsbestand
Dieser Indikator wurde erstmals im Jahr 2025 eingeführt. Der Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen in Stuttgart ist hoch. Angesichts des Wohnraummangels und des hohen Mietniveaus ist es für einkommensschwache Haushalte in Stuttgart besonders schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Häufig sind diese Haushalte auf geförderte Wohnungen und die Hilfe der Stadt angewiesen. Deshalb ist es wichtig, genügend Sozialmietwohnungen zur Verfügung stellen zu können. Der Indikator setzt den Anteil an Sozialmietwohnungen ins Verhältnis zum Gesamtmietwohnungsbestand.
Berechnung:
Anzahl Sozialmietwohnungen / Gesamtmietwohnungsbestand *100
Vermittlung von Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht für Haushalte mit dringendem Wohnbedarf
In welchem Maß es gelingt, Menschen mit geringem Einkommen eine Wohnung mit städtischem Belegungsrecht zu vermitteln, zeigt die Vermittlungsrate, wie oft Haushalten erfolgreich eine Wohnung vermittelt werden konnte, relativ zu allen Haushalten auf der Warteliste. Die Vermittlungsrate von Wohnungen mit städtischem Belegungsrecht setzt die Zahl der vermittelten Haushalte ins Verhältnis zu allen Haushalten in der städtischen Vormerkdatei.
Berechnung:
Anzahl vermittelte Haushalte / Anzahl Haushalte in der städtischen Vormerkdatei insgesamt *100

11.2 Bezahlbare und nachhaltige Verkehrssysteme
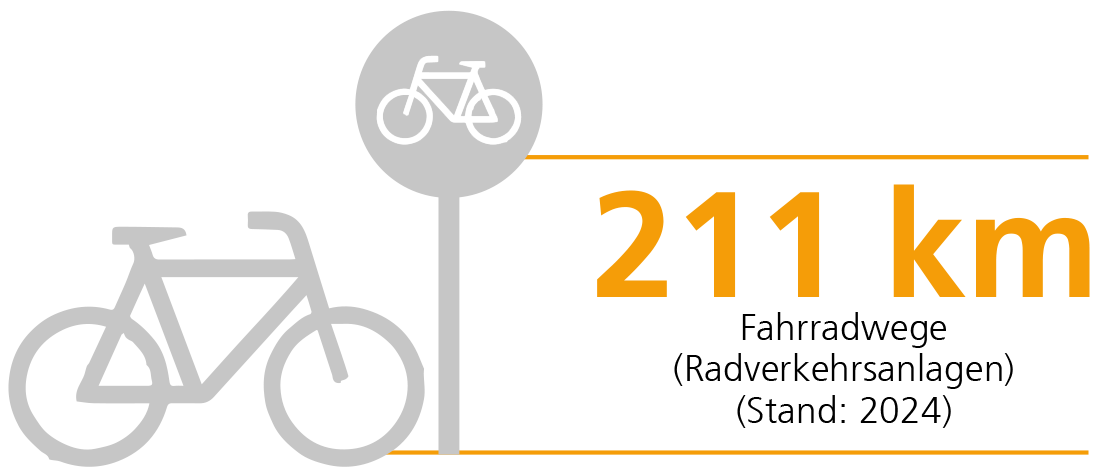
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Wohnen
Verkehrsmittel für den Arbeitsweg (inklusive Fußverkehr)
Als Annäherung an die Verteilung nach Fortbewegungsarten werden hier primär Angaben aus der Stuttgart-Umfrage (früher Bürgerumfrage) genutzt. Darin wird alle zwei Jahre nach den vorrangig genutzten Fortbewegungsarten auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung gefragt, denn dies ist ein werktäglicher, also sehr häufig zurückgelegter Weg. Damit konzentriert sich die Messung auf einen wichtigen Weg, wobei zum Gesamtverkehrsaufkommen selbstverständlich auch viele andere Wege zählen, beispielsweise zum Einkauf oder in der Freizeit. Da bei der Fragestellung Mehrfachnennungen möglich sind, wurden die Einzelwerte auf 100 normiert
Berechnung:
Anzahl Verkehrsteilnehmende auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung zu Fuß, mit dem Fahrrad, E-Bike oder ÖPNV / Anzahl Verkehrsteilnehmende auf dem Weg zur Arbeit oder Ausbildung insgesamt * 100
Pkw-Dichte
Dieser Indikator beschreibt den Motorisierungsgrad in der Landeshauptstadt Stuttgart, welcher durch den Anteil der privaten Pkw je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner über 18 Jahre gemessen wird. Berücksichtigt werden alle Personenkraftwagen einschließlich Kombinationskraftwagen, die nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) zugelassen sind und ein amtliches Kennzeichen tragen.
Berechnung:
Anzahl Privat-Pkw / Einwohnerzahl (über 18 Jahre) * 1000
Personenkraftwagen mit Elektroantrieb
Der Indikator umfasst sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride, die sowohl mit einem Elektro- als auch einem Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Er setzt alle zugelassenen Pkw mit Elektrofahrzeugen (inkl. Plug-in-Hybride) ins Verhältnis zu den zugelassenen Pkw insgesamt.
Berechnung:
Anzahl zugelassene Pkw mit Elektroantrieb / Anzahl zugelassene Pkw insgesamt * 100
Fahrradverkehr
In Stuttgart gibt es 15 fest eingerichtete automatische Fahrradzählstellen. Die erste Dauerzählstelle wurde am 1. Juli 2012 auf der König-Karls-Brücke in Bad Cannstatt an der Hauptradroute 1 eingerichtet. Eine weitere Zählstelle, ebenfalls auf der Hauptradroute 1, befindet sich in Stuttgart-Süd in der Böblinger Straße. Hier wird seit dem 10. Dezember 2013 gezählt, wie viele Radfahrer die Stelle passieren. Der Indikator zieht die Werte dieser beiden Zählstellen heran, weil hier bereits seit 2014 vergleichbare Angaben vorliegen. Eine Ausweitung auf weitere Fahrradzählstellen ist in Zukunft möglich. Der Indikator setzt die Anzahl der gezählten Radfahrten an den beiden Zählstellen in Bezug zu 100 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Berechnung:
Anzahl gezählte Radfahrten/Einwohnerzahl* 100
Fahrradwege
Der im Jahr 2025 eingeführte Indikator gibt an, wie viele Kilometer im Straßennetz eigens für den Radverkehr zur Verfügung stehen.
Berechnung:
Km Fahrradwege gesamt
Barrierefreiheit des ÖPNV
Die Zugänglichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen von großer Bedeutung, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Barrierefreiheit im ÖPNV betrifft eine Vielzahl von Aspekten, die sich nicht leicht in einem einzelnen Indikator abbilden lassen. Der Indikator weist die Zahl der barrierefrei ausgebauten Haltekanten im Busverkehr in Stuttgart ab 2010 aus.
Berechnung:
Anzahl barrierefrei ausgebaute Bus-Haltekanten / Anzahl Bus-Haltekanten insgesamt * 100

11.3 Inklusive und nachhaltige Verstädterung
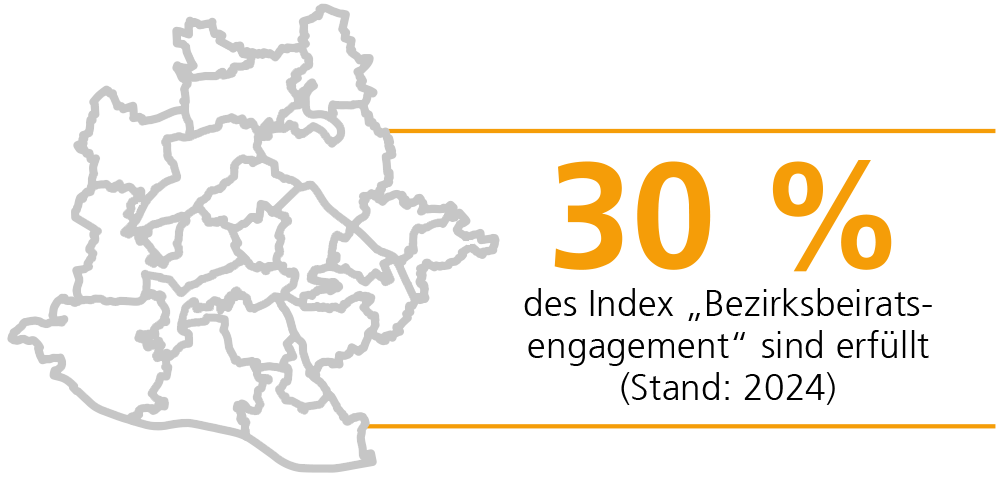
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Statistisches Amt
Jährlicher Flächenverbrauch
Als Flächenverbrauch wird der jährliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche bezeichnet. Dabei werden bisher unbebaute Flächen in der Regel durch Überbauung einer siedlungsstrukturellen Nutzung zugeführt. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche entspricht jedoch nicht der versiegelten Fläche, da sie einige gering bebaute Nutzungsarten wie Grünanlagen, Campingplätze und Friedhöfe einschließt. Darüber hinaus enthält die Siedlungs- und Verkehrsfläche der jeweiligen Hauptnutzung untergeordnete Flächenanteile, die unversiegelt sind. Dazu gehören beispielsweise Vorgärten von Wohngebäuden oder Straßenbegleitgrün.
Berechnung:
Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha – Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha des Vorjahres
Index zum Bezirksbeiratsengagement im Kontext der Internationalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
Der Index zum Bezirksengagement ist ein Summenindex aus neun dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen. Auf den Fragebogen haben 13 der 23 Stadtbezirke der Landeshauptstadt Stuttgart geantwortet und sind im Indexwert entsprechend berücksichtigt. Der Index wurde vom Statistischen Amt der Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt
Berechnung:
Anzahl in der Kommune umgesetzte Kriterien
(Ja-Antworten) / Gesamtzahl der zu prüfenden Kriterien (9) *100

11.7 Zugang zu sicheren und inklusiven Grünflächen und öffentlichen Räumen gewährleisten
Naherholungsflächen
Der Indikator setzt die Flächen von Grünanlagen und Freizeitflächen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl der Stadt. Er beinhaltet auch Sportflächen (siehe SDG 3 „Urbane Bewegungsräume“), geht aber darüber hinaus, da alle Grün- und Erholungsflächen einbezogen werden.
Berechnung:
Fläche von Grünanlagen und Freizeitflächen / Einwohnerzahl

11.b Umsetzung von Politiken und Plänen zur Inklusion, Ressourceneffizienz und Katastrophenrisikominderung
Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie
Der Indikator setzt neu errichtete Wohngebäude, die primär mit erneuerbarer Energie geheizt werden, ins Verhältnis zu allen neu errichteten Wohngebäuden eines Jahres. Zu erneuerbarer primärer Heizenergie zählen Geothermie, Umweltthermie (Luft/Wasser), Solarthermie, Holz, Biogas sowie sonstige Biomasse.
Berechnung:
Anzahl fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer primärer Heizenergie / Anzahl fertiggestellte Wohngebäude insgesamt * 100
SDG 12: Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion
Relevante Themen des SDG 12 für deutsche Kommunen zur Sicherstellung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster sind insbesondere eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, die Verringerung von Nahrungsmittelverschwendung, die Senkung des Abfallaufkommens, die Motivation von Unternehmen zu nachhaltigem Handeln und die Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung.
Folgende Unterziele des SDG 12 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umsetzen
Fairtrade-Schools
Der Indikator gibt den Anteil der Fairtrade-Schools an allen Stuttgarter Schulen an. Die Kampagne der „Fairtrade-Schools“ bietet Schulen die Möglichkeit, das Thema Fairer Handel in den Schulalltag zu integrieren, und schafft bei den Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung. Um Teil der Kampagne zu werden, müssen Schulen fünf Kriterien erfüllen, die faires Handeln und Engagement auf verschiedenen Ebenen widerspiegeln. Darüber hinaus unterstützt die Kampagne die Schulen bei der Entwicklung lokaler Projekte zur Verbreitung von Informationen über fairen Handel.
Berechnung:
Anzahl Fairtrade-Schools / Anzahl Schulen insgesamt * 100

12.5 Erhebliche Verringerung des Abfallaufkommens
Abfallmenge – gesamt
Der Indikator Abfallmenge beschränkt sich auf die häuslichen Abfälle und berücksichtigt betriebliche Abfälle nicht. Für die Berechnung des kommunalen Abfallaufkommens in Kilogramm pro Einwohnerin und Einwohner werden die gesammelten Mengen an Haus- und Sperrabfall, Grün- und Bioabfall sowie alle weiteren getrennt erfassten Wertstoffe (u. a. Altpapier, Altglas, Leichtverpackungen, E-Schrott) erhoben. In der Auswertung nicht berücksichtigt sind die separat erfassten Gewerbe- und Baustellenabfälle, die zwar dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger überlassen werden können, aber grundsätzlich keiner unmittelbaren, kommunalen Überlassungspflicht unterliegen. Sie sind daher nicht unmittelbar zu den häuslichen Abfällen beziehungsweise den unter kommunaler Regie erfassten Pro-Kopf-Abfallmengen zu zählen. Dagegen werden die durch die kommunale Schadstoffsammlung erfassten Problemabfälle den Rest- und Sperrabfällen hinzugerechnet. Der Indikator bildet die pro Jahr anfallende Menge an Abfällen in Bezug auf die Einwohnerzahl Stuttgarts ab. Der Wertstoffanteil weist den Anteil weiterverwertbarer Stoffe im Abfall aus.
Berechnung:
Gesamtmenge Abfälle in kg / Einwohnerzahl
Menge Wertstoffe, Grün- und Bioabfälle in kg / Gesamtmenge Abfälle in kg * 100

12.6 Ermutigung von Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Verfahren und zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
EMAS-zertifizierte Standorte
Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ist ein europäisches Zertifizierungssystem, um die Umweltverträglichkeit von Betrieben zu prüfen. Dabei verpflichten sich Betriebe, den Energie- und Ressourceneinsatz – über die gesetzlichen Vorgaben hinaus – ökologisch auszurichten. Regelmäßige Berichtspflichten und Prüfungen durch staatlich beaufsichtigte Umweltgutachterinnen und -gutachter gehören ebenfalls zum Anforderungsprofil. Die EMAS-Zertifizierung bildet umweltverträgliche Betriebsabläufe zuverlässig ab. Allerdings können sich auch unzertifizierte Betriebe an Umweltkriterien ausrichten, die so den Aufwand einer Zertifizierung umgehen. Die Anzahl der umweltorientiert arbeitenden Betriebsstandorte wird somit unterschätzt. Die EMAS-Zertifizierung erfolgt für Betriebsstandorte. Die Anzahl der EMAS-Standorte bezieht sich auf das Postleitzahlengebiet von Stuttgart (PLZ 70xxx). Da die Gesamtzahl von Betriebsstandorten in der Landeshauptstadt Stuttgart nicht bekannt ist, kann ein prozentualer Anteil der EMAS-Standorte nicht ermittelt werden. Die Daten für die einzelnen Jahre sind nur näherungsweise zu verstehen, da im Laufe eines Jahres Zertifikate hinzukommen oder auslaufen können.
Berechnung:
Anzahl EMAS-zertifizierte Standorte
Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden Gewerbe
Umweltschutzinvestitionen im produzierenden Gewerbe sind eine wichtige Messgröße für die Anstrengungen der Unternehmen und Betriebe zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit ihrer Produktion. Als Produzierendes Gewerbe werden Bergbau, Energiewirtschaft, Verarbeitendes Gewerbe sowie das Baugewerbe bezeichnet. Investitionen in Anlagen, die zur Verringerung, Vermeidung oder Beseitigung von Emissionen in die Umwelt beitragen oder eine schonendere Nutzung der Ressourcen ermöglichen, werden als Umweltschutzinvestitionen bezeichnet. Diese werden in fünf Bereiche aufgeteilt: Abwasserwirtschaft, Klimaschutz, Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft sowie Lärm- und Erschütterungsschutz, Arten- und Landschaftsschutz und Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser.
Berechnung:
Umweltschutzinvestitionen im Produzierenden Gewerbe
nach Umweltbereichen in Mio. Euro

12.7 Förderung nachhaltiger Verfahren im öffentlichen Beschaffungswesen
Nachhaltige Beschaffungsverfahren
Der Anteil nachhaltiger Beschaffungen wird durch den Zentralen Einkauf jährlich auf Basis der Vergabenummernliste geschätzt.
Berechnung:
Anzahl nachhaltige Beschaffungsverfahren / Anzahl Beschaffungsverfahren insgesamt * 100
SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 13 sind insbesondere die Stärkung der Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sowie der Aufbau von Wissen und Kapazitäten zum Umgang mit dem Klimawandel sowie die Förderung von Mechanismen zur Stärkung der Planungs- und Managementkapazitäten.
Folgende Unterziele des SDG 13 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

13.1 Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Katastrophen

Waldfläche
Der Indikator Waldfläche ist definiert als der Anteil bewaldeter Fläche an der Gesamtfläche der Landeshauptstadt Stuttgart. Waldflächen sind nicht nur wichtig, um das Klima zu schützen, sondern auch, um die Biodiversität zu erhalten.
Berechnung:
Waldfläche / Gesamtfläche * 100
Bäume im öffentlichen Raum
Die Daten bilden nur Bäume auf öffentlichen Grünflächen und im Straßenraum ab. Nicht enthalten sind beispielsweise Bäume in Wäldern, waldartigen Beständen und auf Friedhöfen. Der Indikator ist definiert als die Anzahl von Einzelbäumen relativ zur Gesamtfläche des öffentlichen Raums.
Berechnung:
Anzahl Bäume auf öffentlichem Grund / Gesamtfläche öffentlicher Raum in ha
Index „Kommunale Klimaanpassung“
Der Index „Kommunale Klimaanpassung“ ist ein Summenindex aus zehn dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen aus dem Wegweiser für Kommunen
Berechnung:
Anzahl in der Kommune umgesetzte Kriterien (Ja-Antworten) / Gesamtzahl zu prüfende Kriterien (Fragen: 10) * 100

13.2 Integration von Klimaschutzmaßnahmen in Politik und Planung
Treibhausgas-Ausstoß
Der Indikator setzt den Treibhausgas-Ausstoß jeweils ins Verhältnis zu den Nutzenden. Im Fall der Treibhausgas-Emissionen in Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistung sind dies die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB), im Falle von Verkehr und privaten Haushalten ist es die Einwohnerzahl
Berechnung:
Treibhausgas-Ausstoß – Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie:
CO2-Äquivalente der Emissionen von Gewerbe,
Handel, Dienstleistung und Industrie / Anzahl Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in
Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie
Treibhausgas-Ausstoß – Verkehr:
CO2-Äquivalent der Emissionen durch den Verkehr / Einwohnerzahl
Treibhausgas-Ausstoß – private Haushalte:
CO2-Äquivalente der Emissionen durch private Haushalte / Einwohnerzahl
Treibhausgas-Ausstoß – Gesamtstadt:
CO2-Äquivalente der Emissionen aller Sektoren
SDG 14: Leben unter Wasser
Für deutsche Kommunen relevante Themen des SDG 14 sind insbesondere die Verringerung aller Formen der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Land ausgehende Tätigkeiten, die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen.
Folgende Unterziele des SDG 14 sind für deutsche Kommunen relevant, im Bericht aber noch nicht durch Indikatoren abgedeckt:

14.1 Verringerung der Meeresverschmutzung

14.7 Steigerung des wirtschaftlichen Vorteils einer nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen

14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern
SDG 15: Leben an Land
Relevante Themen des SDG 15 für deutsche Kommunen sind insbesondere der Schutz von Landökosystemen, die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes, die Wiederherstellung degradierter Flächen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt.
Folgende Unterziele des SDG 15 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

15.1 Erhaltung und Wiederherstellung von Land- und Süßwasser- Ökosystemen

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung (SES)
Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer
Der Indikator „Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer“ gibt den Anteil der Fließgewässerkilometer von Gewässern II. Ordnung im Stadtgebiet Stuttgart an, die sich in einem naturnahen oder renaturierten Zustand befinden. Beim Neckar in Stuttgart handelt es sich um eine Bundeswasserstraße. Zuständig für die Verwaltung, den Unterhalt und die Entwicklung von Bundeswasserstraßen ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Für den Neckar ist dies das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar. Der Neckar ist folglich bei dem Indikator „Renaturierungsmaßnahmen Fließgewässer“ nicht berücksichtigt.
Berechnung:
Länge renaturierte Fließgewässer / Länge ursprünglich technisch verbaute und verdolte Fließgewässer * 100

15.3 Beendigung der Wüstenbildung und Wiederherstellung degradierter Flächen
Bodenindex
Bei der Erhebung des Flächenverbrauchs wird die Entwicklung des Anteils der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche bilanziert. Dabei spielt die Qualität der in Anspruch genommenen Böden keine Rolle. Boden zählt zu den Ressourcen, die sich in menschlichen Zeiträumen kaum erneuern. Daher ist die ökonomische Bewirtschaftung der örtlichen Bodenvorräte zentraler Bestandteil für Erfolg versprechende Konzepte zum nachhaltigen Bodenschutz. Weil klassische Verbrauchsmuster, wie etwa der Bau von Einzelhausgebieten im Außenbereich, die Ressource unweigerlich aufzehren und weil Beanspruchungen des Bodens kaum wirkungsvoll ausgeglichen werden können, ist Nachhaltigkeit ausschließlich dann erreichbar, wenn in einem definierten Betrachtungsraum ein konstanter, möglichst guter Bodenzustand (d. h. ein definierter Standard an Funktionserfüllung = Bodenqualität) garantiert werden kann. Dies ist nur möglich, wenn der Neuverbrauch von Böden konsequent reduziert wird, um schließlich eine Flächenkreislaufwirtschaft zu erreichen.
Berechnung:
Für die Berechnung des Bodenindex wird der spezifische
Qualitätszustand einer Bodenfläche durch Multiplikation der
Bodenflächenanteile (ha) mit dem Wert der zugehörigen Bodenqualitätsstufen
(Wert/ha) berechnet und in sogenannten Bodenindex-
Punkten (dimensionslos) beziffert. Die Daten beziehen
sich bis 2023 jeweils auf den Stichtag 30. April eines Jahres. Der
Wert für 2024 bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.05.2023
bis zum 31.12.2024.

15.5 Schutz der biologischen Vielfalt und der natürlichen Lebensräume

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz
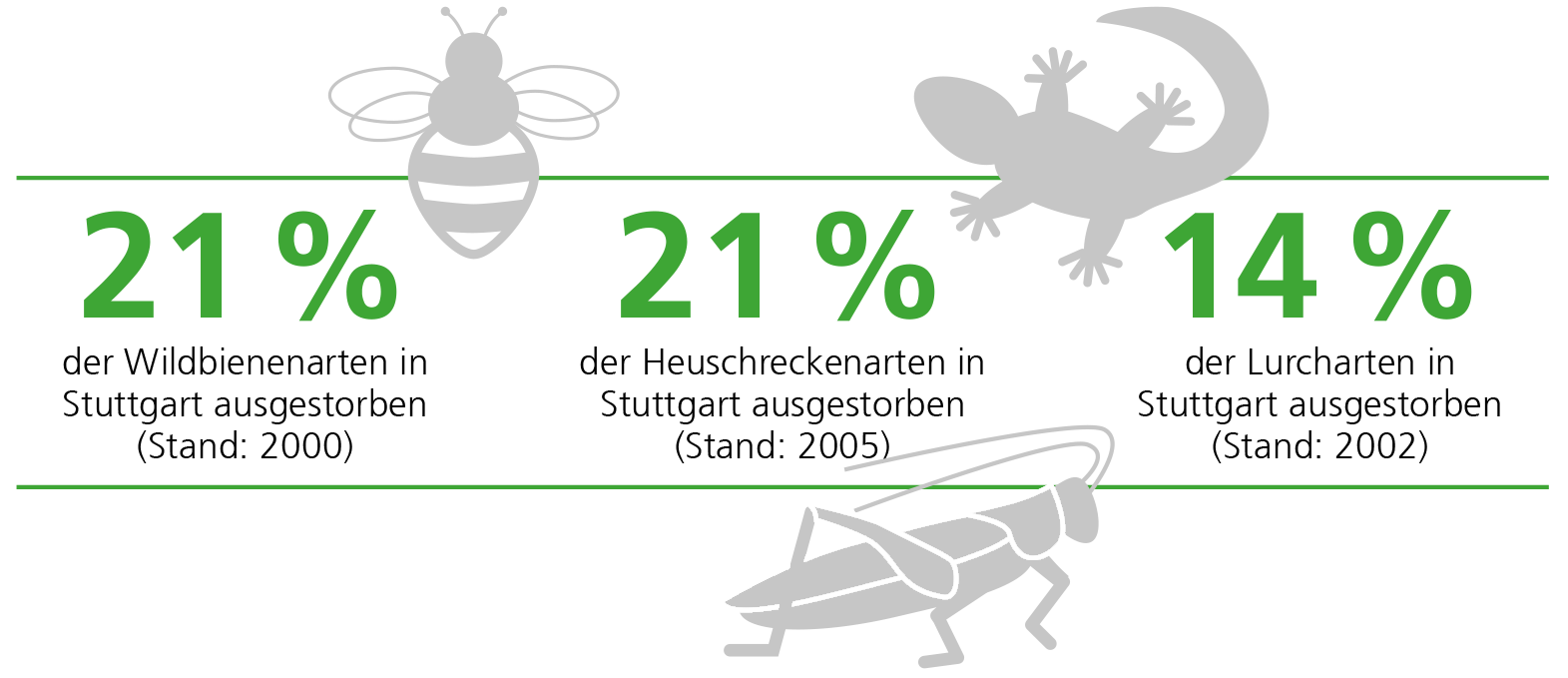
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz
Naturschutzflächen
Der Indikator beschreibt die Flächenanteile von drei verschiedenen Naturschutzflächen:
(a) Natura 2000-Gebiete (Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiete) dienen als europäisches Schutzgebietssystem nach einem Beschluss von 1992 dem Aufbau und der Erhaltung eines Netzes natürlicher und naturnaher Lebensräume.
(b) Naturschutzgebiete dienen der Erhaltung großflächiger Naturdenkmale und besonders geschützter Biotope. Dabei sind Landschaftsteile möglichst ungestört zu erhalten, zu schützen und zu pflegen. Wesentliche Veränderungen sind verboten.
(c) Landschaftsschutzgebiete dienen nicht nur dem Schutz des Naturhaushaltes, sondern auch der Sicherung der Erholungsfunktion der Bürgerinnen und Bürger.
Berechnung:
Gesamtfläche Schutzgebiete in Stuttgart / Gesamtfläche Stuttgart * 100
Biodiversität
Der Indikator beruht auf der Kategorisierung dreier exemplarisch herangezogener Tierarten nach ihrem Gefährdungsstatus:
(Biodiversität A): Wildbienenarten nach Gefährdungsstatus entsprechend der Roten Liste Baden-Württemberg
(Biodiversität B): Heuschreckenarten nach Gefährdungsstatus entsprechend der Roten Liste Baden-Württemberg
(Biodiversität C): Amphibienarten nach Gefährdungsstatus entsprechend der Roten Liste Baden-Württemberg
Berechnung:
Gefährdete Arten in Stuttgart / Arten gesamt in Stuttgart * 100
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Relevante Themen von SDG 16 für deutsche Kommunen sind insbesondere die Reduzierung von Gewalt, der Schutz von Kindern vor Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und Gewalt, die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, die Reduzierung von Korruption, der Aufbau leistungsfähiger, rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen sowie die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger.
Folgende Unterziele des SDG 16 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

16.1 Gewalt überall verringern
Gewaltsame Todesfälle
Dieser Indikator wurde 2025 eingeführt. Die Daten zu den gewaltsamen Todesfällen beinhalten Fälle von Mord und Totschlag. Der Indikator ist zentral für die Beurteilung der Sicherheit in Stuttgart.
Berechnung:
Anzahl gewaltsame Todesfälle pro Jahr / Einwohnerzahl * 100 000

16.2 Schutz von Kindern vor Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und Gewalt
Gewalt im familiären Umfeld gegen Kinder und Jugendliche
Aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von Erwachsenen sind Kinder besonders schutzbedürftig. Die hier abgebildete Statistik stellt nur die tatsächlich gemeldeten Fälle dar. Die Dunkelziffer ist vermutlich sehr viel höher. Eine Studie des Bundeskriminalamtes zeigt beispielsweise, dass Körperverletzungen nur in in einem Drittel der Fälle zur Anzeige gebracht werden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) bietet daher kein vollständiges Abbild der Kriminalitätswirklichkeit, sondern stellt je nach Deliktart eine mehr oder weniger präzise Annäherung dar. Bei der PKS handelt es sich um eine Ausgangsstatistik. Das bedeutet, dass die der Polizei bekannt gewordenen Straftaten erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen bei der Aktenabgabe an die Staatsanwaltschaft oder das Gericht erfasst werden. Folglich erfasst die PKS die in einem Kalenderjahr polizeilich abgeschlossenen Taten unabhängig vom Zeitpunkt der Tatbegehung. Die häufigsten Formen von Gewalt im familiären Umfeld, die Kinder und Jugendliche betreffen, sind Körperverletzungen, gefolgt von Misshandlungen von Schutzbefohlenen.
Berechnung:
Anzahl berichtete Fälle häuslicher Gewalt
gegen Minderjährige pro Jahr / Einwohnerzahl (unter 18 Jahre) * 1000

16.4 Bekämpfung der organisierten Kriminalität
Straftaten
Der Indikator bildet die polizeilich bekannt gewordenen Straftaten relativ zur Bevölkerungszahl ab und spiegelt die allgemeine Kriminalitätsentwicklung in der Stadt wider. Die PKS ermöglicht darüber hinaus differenziertere Betrachtungen, etwa nach einzelnen Arten von Delikten. Dem steht ein erhebliches Dunkelfeld an Straftaten gegenüber. Die Kriminalstatistik deckt also nur einen Teil der tatsächlich vorkommenden Kriminalität ab. Die Fallzahlen in Bezug zur Bevölkerungszahl zu setzen ist sinnvoll, um die Anzahl potenzieller Täterinnen und Täter und Opfer zu berücksichtigen. Allerdings wird bei der Berechnung des Indikators nicht berücksichtigt, dass es sich bei potenziellen Täterinnen und Tätern und Opfern auch um Personen von außerhalb Stuttgarts handeln kann. Die angegebenen Zahlen weichen von anderen Veröffentlichungen ab, da als Bezugsgröße die Einwohnerzahl nach Melderegister verwendet wird.
Berechnung:
Anzahl polizeilich bekannt gewordene Straftaten / Einwohnerzahl * 1000

16.5 Erhebliche Verringerung von Korruption und Bestechung
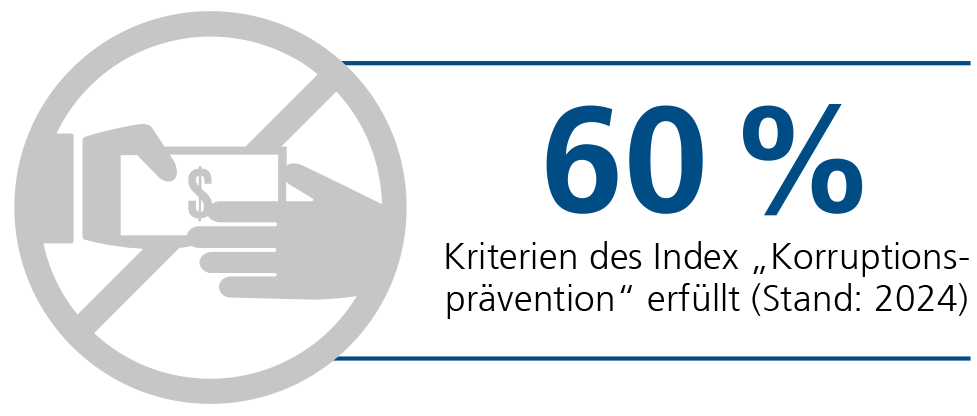
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Revision
Korruptionsprävention
Der Index „Korruptionsprävention“ ist ein Summenindex aus elf dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen
Berechnung:
Anzahl in der Kommune umgesetzte Kriterien (Ja-Antworten) /Anzahl zu prüfende Kriterien (11) * 100

16.6 Aufbau leistungsfähiger, rechenschaftspflichtiger und transparenter Institutionen
Mobiles Arbeiten
Zur Berechnung des Indikators „Mobiles Arbeiten“ wird die Anzahl der Beschäftigten mit einem E-Mail-Account näherungsweise ermittelt. Dies geschieht mithilfe der Daten zu den Abrechnungen der Mail-Datenbanken und dem Verhältnis von Personen- zu Funktionspostfächern unter der Annahme, dass das Verhältnis immer gleich ist (78,4 % Personenpostfächer / 21,6 % Funktionspostfächer). Der 31. März eines jeden Jahres ist als Stichtag festgelegt.
Berechnung:
Mobile Endgeräte mit VPN bei der Landeshauptstadt Stuttgart / Anzahl Beschäftigte mit E-Mail-Adresse * 100
Städtische Gesamtverschuldung
Der Indikator zeigt den Schuldenstand im städtischen Gesamthaushalt einschließlich der Verschuldung der Eigenbetriebe relativ zur Einwohnerzahl. Die Schulden der eigenständigen städtischen Beteiligungsunternehmen sind in der Betrachtung nicht enthalten.
Berechnung:
Verschuldung der Kommune in allen Teilhaushalten / Einwohnerzahl
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf für die dauerhafte Aufgabenerfüllung
Der Indikator gibt Auskunft darüber, inwieweit eine Kommune aus eigener Kraft und ohne Kreditaufnahme in der Lage ist, die regulären Auszahlungen für die laufenden Verwaltungstätigkeiten zu tätigen. Ein Zahlungsmittelbedarf, also ein negatives Vorzeichen, macht strukturelle Maßnahmen im Ergebnishaushalt notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss ist eine wichtige Messgröße zur Beurteilung der finanziellen Situation einer Kommune. Er muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können. Der Wert für das Jahr 2022 hat sich im Nachhinein nochmals verändert, weshalb er von dem in der Bestandsaufnahme 2023 berichteten Wert leicht abweicht.
Berechnung:
Saldo Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Gewerbesteuer-Quote
Die Gewerbesteuer wird grundsätzlich auf alle gewerblich tätigen Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften erhoben. Gegenstand der Steuer ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft, also der Gewinn. Die Gewerbesteuer zählt zu den wichtigsten Steuern einer Kommune in Deutschland. Es handelt sich um eine der wenigen relevanten Einnahmequellen, die eine Kommune direkt beeinflussen kann. Die Höhe der Gewerbesteuer kann der Gemeinderat durch den Hebesatz steuern. Das gesetzliche Minimum beträgt 200 vom Hundert. In Stuttgart liegt der Hebesatz derzeit bei 420 vom Hundert. Die Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegen starken Schwankungen. Die Hauptfaktoren sind dabei die Entwicklung der Konjunktur und die der Branchenstruktur. Die Gewerbesteuerumlage soll wiederum regionale Unterschiede bundesweit abfedern. Der Indikator zeigt an, inwieweit die Erfüllung der Leistungen der Kommune abhängig von einer positiven konjunkturellen oder branchenstrukturellen Entwicklung ist. Je geringer die Gewerbesteuerquote desto stärker ist der städtische Haushalt abhängig von den allgemeinen bundes- und landesweiten Steuererträgen und von den Zuweisungen des Landes. Um ihr Aufgabenportfolio zuverlässig und nachhaltig zu finanzieren, sind die Kommunen auf eine möglichst stabile Gewerbesteuer angewiesen.
Berechnung:
Gewerbesteueraufkommen abzgl. Gewerbesteuerumlage / Ordentliche Erträge * 100

16.7 Gewährleistung einer bedarfsorientierten, inklusiven, partizipatorischen und repräsentativen Entscheidungsfindung
Digitale Kommune
Die Digitalisierung ist ein Indikator für die Zukunftsfähigkeit der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie schreitet in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen dynamisch voran und prägt vermehrt die Verwaltungsabläufe. Im Sinne der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit ist daher eine Intensivierung der Aktivitäten der Stadtverwaltung in diesem Bereich erforderlich. Der Indikator gibt Aufschluss über den Grad der Digitalisierung kommunaler Prozesse. Hierzu werden 16 Fragen erhoben
Berechnung:
Anzahl in der Kommune umgesetzte Kriterien (Ja-Antworten) / Gesamtzahl zu prüfende Kriterien (16) * 100
Beteiligung von Jugendlichen
Jugendliche einzubinden in Entscheidungsverfahren und politische Repräsentation kann ein Weg sein, Menschen bereits in jungen Jahren mit Partizipation vertraut zu machen und so langfristig die politische Beteiligung zu verbessern. Die Jugendräte in Stuttgart sind institutionalisierte Foren, in denen Jugendliche ihre Anliegen vorbringen und diskutieren können.Der Indikator „Beteiligung von Jugendlichen“ gibt die institutionalisierte Einbindung der Jugendlichen in zwei Messgrößen wieder. Hierbei wird der Anteil von Stadtbezirken ausgewiesen, die einen Jugendrat haben. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die zum jeweils letzten Wahltag mindestens 14 und noch nicht 19 Jahre alt sind. In allen 23 Stadtbezirken von Stuttgart finden Jugendratswahlen statt, wobei sich einige Stadtbezirke zu Wahlbezirken zusammengeschlossen haben.
Berechnung:
Anzahl Stadtbezirke mit einem Jugendrat / Anzahl Stadtbezirke insgesamt * 100
Registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf „Stuttgart – meine Stadt“
Auf dem Portal „Stuttgart – meine Stadt“ können sich interessierte Einwohnerinnen und Einwohner frühzeitig über kommunale Beteiligungsprojekte sowie über alle sonstigen städtischen Vorhaben informieren. Das Projekt ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Der Indikator zeigt die Entwicklung der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die sich auf dem Onlineportal registriert haben.
Berechnung:
Anzahl registrierte Nutzerinnen und Nutzer auf www.stuttgart-meine-stadt.de / Einwohnerzahl (über 16 Jahre) * 100
Bürgerhaushalt
Mit dem Bürgerhaushalt haben Stuttgarterinnen und Stuttgarter alle zwei Jahre die Möglichkeit, sich aktiv in die Haushaltsplanungen einzubringen. In der Vorschlagsphase besteht die Möglichkeit, sich mit eigenen Vorschlägen in den Bürgerhaushalt einzubringen, in der anschließenden Bewertungsphase können registrierte Nutzerinnen und Nutzer dann alle eingereichten Vorschläge mit „gut für unsere Stadt“ oder „weniger gut für unsere Stadt“ bewerten. Die 100 Vorschläge, die am besten bewertet werden, und die zwei beliebtesten Vorschläge für jeden Stadtbezirk werden von der Verwaltung geprüft, dann dem Bezirksbeirat zur Stellungnahme vorgelegt und für die Haushaltsberatungen im Herbst vorbereitet. Die Vorschläge müssen realisierbar und finanzierbar sein sowie in die Zuständigkeit der Stadt fallen.
Berechnung:
Anzahl Teilnehmende am Bürgerhaushalt / Einwohnerzahl * 100
Zufriedenheit mit der Arbeit der Stadtverwaltung (bzw. Bürgerbüros)
Die Daten zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Stadtverwaltung (und der Bürgerbüros) werden im Rahmen der Bürgerumfrage im Turnus von zwei Jahren erfasst. Der Indikator stellt den Anteil der befragten Bürgerinnen und Bürger dar, die angeben, mit der Arbeit der Stadtverwaltung sehr zufrieden oder zufrieden zu sein.
Berechnung:
Anzahl zufriedener und sehr zufriedener Bürgerinnen und Bürger / Einwohnerzahl * 100

16.10 Öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten
Verwaltungsleistungen online
Der Indikator beschreibt die Anzahl der Verwaltungsleistungen, die für die Bürgerinnen und Bürger online angeboten werden. Der Stichtag der Erhebung der Daten ist immer der 15. Juni eines Jahres.
Berechnung:
Anzahl online angebotene Verwaltungsleistungen
SDG 17: Globale Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Das SDG 17 bezieht sich allgemein auf die Stärkung der Ressourcen zur Umsetzung der Agenda 2030 sowie darauf, Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen zu stärken. Für Kommunen sind dabei unter anderem die Bildung und der Ausbau von Partnerschaften sowie die Mobilisierung von Ressourcen aus verschiedenen Quellen, sowohl vor Ort als auch in Ländern im Globalen Süden, relevante Themen.
Folgende Unterziele des SDG 17 sind für deutsche Kommunen relevant und bereits durch Indikatoren abgedeckt:

17.6 Wissensaustausch und Verstärkung der Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit
Studierende aus dem Globalen Süden
Der Indikator beschreibt den Anteil ausländischer Studierender an der Gesamtzahl aller Studierenden an Universitäten und Hochschulen in Stuttgart für die drei folgenden Gruppen:
1) Anteil der Studierenden aus Least Developed Countries (LDCs) nach der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
2) Anteil Studierender aus Entwicklungsländern (ohne LDCs nach OECD)
3) Anteil ausländischer Studierender (ohne Entwicklungsländer und ohne LDCs, inkl. übriges Asien, ohne Angabe, staatenlos und ungeklärt).
Berechnung:
Anzahl Studierende aus Entwicklungsländern (ohne LDCs) bzw. Anzahl Studierende aus LDCs bzw. Anzahl ausländische Studierende (ohne LDCs und ohne Entwicklungsländer) / Anzahl Studierende an Stuttgarter Hochschulen und Universitäten insgesamt * 100

17.16 Ausbau der globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung
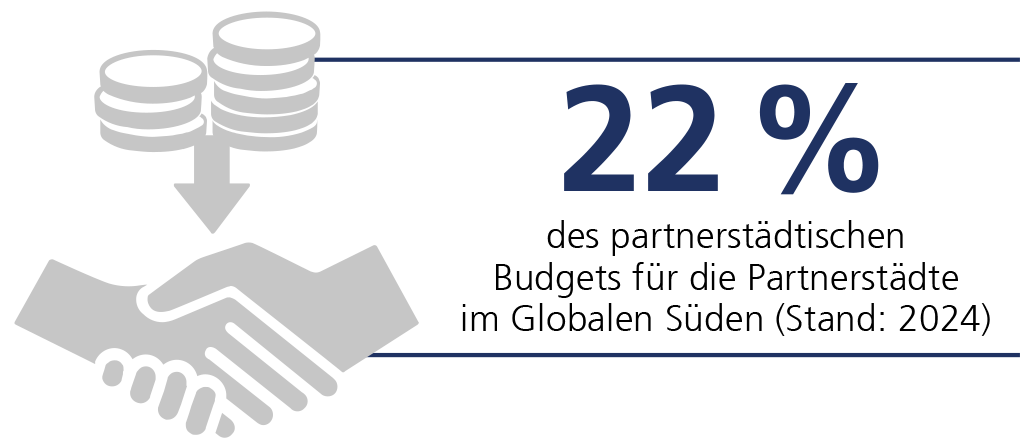
Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Außenbeziehungen
Partnerstädte im Globalen Süden
Der Indikator bildet die durchschnittlich verwendeten Mittel für die Zusammenarbeit mit und in Partnerstädten im Globalen Süden im Verhältnis zum Durchschnitt der für partnerstädtische Arbeit zur Verfügung stehenden Mittel der Abteilung Außenbeziehungen in den Jahren 2008 bis 2024 ab.
Berechnung:
Mittel für Zusammenarbeit mit Partnerstädten im Globalen Süden / Freies Projektmittelbudget der Abteilung Außenbeziehungen * 100
Projekte und Beratungsleistung
Der Indikator „Projekte und Beratungsleistung“ umfasst Beratungs- und Unterstützungsleistungen in den Kernbereichen der Abteilung Außenbeziehungen entsprechend den Kennzahlen im Haushaltsplan.
Berechnung:
Der Indikator gibt die Anzahl der durchgeführten Beratungs und Unterstützungsleistungen in den Kernbereichen der Abteilung Außenbeziehungen für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 an.
Praxisbeispiele für eine lebenswerte Stadt
- Strategie zur sozialen Quartiersentwicklung – Entwicklung und Umsetzung einer Rahmenkonzeption;
- Finanzielle Förderung für Menschen mit einer Bonuscard + Kultur / Gutscheine für Bewegung;
- Stuttgarter Alterssurvey 2024;
- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in den Stuttgarter Stadtbezirken;
- Housing First;
- 4. Stuttgarter Armutskonferenz 2023;
- Familien- und Bonuscard;
- Stuttgarter Armutskonferenz 2019 - Vernetzt gegen Armut;
- Konzeption Kinderfreundliches Stuttgart 2015-2020 und Bewerbung um das Siegel Kinderfreundliche Kommune;
- Quartierbedarfserhebung der Landeshauptstadt Stuttgart;
- Aufsuchende, muttersprachliche Befragung älterer Menschen in Stuttgart Wangen;
- Stadtteilhäuser
- Kostenlose Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Übergewicht und Adipositas;
- New Food Festival Stuttgart;
- Gesunde, nachhaltige und klimafreundliche Ernährung;
- Stuttgarter Stufenmodell zur Übergewichtsprävention und -therapie;
- Gesund aufwachsen in der Neckarvorstadt;
- Städtische Unterstützung für Stuttgarter Landwirtinnen und Landwirte;
- Einrichtung eines BioMarktes
- Gemeinsam gegen Einsamkeit;
- Sport im Park;
- Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen;
- Kommunale Pflegekonferenz“;
- schwimmfit – Sicher Schwimmen in Stuttgart“;
- Urbane Bewegungsräume;
- Fachtag „Männer: Fokus Gesundheit“;
- Projekt „TrotzAlter: unabhängig, mittendrin“;
- Bewegungspass Stuttgart/Bewegungspass BW;
- Gemeinschaftserlebnis Sport (GES);
- Gesundheitslotsinnen und -lotsen informieren Zugewanderte zu Corona;
- Maßnahmen zur Luftreinhaltung
- Bibliothekspädagogische Arbeit;
- Von der Umweltbildung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung: Das kommunale BNE-Netzwerk Stuttgart;
- Bildungs- und Kulturprogramm der Stadtbibliothek;
- Ganztagsgrundschulen in Stuttgart;
- Lückenschluss im Netz der Stadtbibliothek;
- Netzwerke für erfolgreiche Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen;
- Dialogischer Planungsprozess für einen kommunalen Ort der Begegnung, Bildung und Nachhaltigkeit;
- Projekt Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen (LESS);
- Vorbereitungsklassen entdecken die Stuttgarter Natur;
- Projekt „Ich bin ein Klimaheld! Wer geht – bewegt!“;
- Bildung für nachhaltige Entwicklung – Angebote für Stuttgarter Schulen zu den SDGs;
- Schulentwicklungsvorhaben „Wolke 13“;
- Kommunales BNE-Netzwerk „Natur erleben Stuttgart“
- Chancengleichheit für LSBTIQ+ – Queer im Alter;
- „Wasenboje“ und „Nachtboje“ – Sicherheit von Mädchen* und Frauen* im öffentlichen Raum;
- Chancengleichheit für LSBTTIQ;
- SINA – Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreichen;
- STOP – Stuttgarter Ordnungspartnerschaft gegen häusliche Gewalt;
- Themengebiet „Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt“;
- Umsetzung der geschlechtersensiblen Sprache für die Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart
- Kommunale Wärmeplanung;
- Stadtwerke Stuttgart – Umsetzung der Strom-, Wärme- und Verkehrswende;
- Solaroffensive und Aktion Gebäudesanierung;
- Energetische Modernisierung in der Stadtverwaltung;
- Das Energiewende-Angebot der Stadtwerke Stuttgart;
- Elektroroller-Mietangebot stella-sharing;
- Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“;
- Die Energiewende erleben mit den Solarbänken der Stadtwerke Stuttgart und der BW-Bank
- Mit der Stuttgart-Crowd der Stadtwerke Stuttgart werden nachhaltige und umweltfreundliche Projekte aus und für Stuttgart finanziert
- Nachhaltigkeit und KI: Der Green AI Day der Landeshauptstadt Stuttgart;
- Landeshauptstadt Stuttgart als soziale Arbeitgeberin;
- „AktivA – Aktive Bewältigung von Arbeitslosigkeit“;
- Jobcenter Stuttgart – zugelassener kommunaler Träger;
- Jugendberufshilfemaßnahme „400+Zukunft“;
- Gesundheitsförderung für arbeitslose Menschen;
- Nachhaltig und flexibel: Modulbauten zur Unterbringung Geflüchteter;
- Nachhaltiger, effizienter und intelligenter Lieferverkehr durch Digitalisierung;
- Gründerbüro;
- M.TECH Accelerator – Unterstützungsprogramm für High-Tech Gründung;
- Das Stuttgarter Welcome Center – gelingendes Ankommen durch zentrale Servicestelle;
- Hochschulkooperation;
- Zukunftslabor Kultur;
- Internationale Studierende in Stuttgart: „Your Start in Stuttgart and the Region“ und „Your Future in Stuttgart“
- Interkulturelle Öffnung und Ausrichtung der Verwaltung;
- Gemeinsam gegen Einsamkeit;
- Programm „Kita für alle“;
- Stuttgarter Bündnis für Integration – Es braucht die gesamte Stadtgesellschaft damit Integration gelingt;
- Förderung der Ausbildung junger Geflüchteter;
- Willkommenspatinnen und -paten;
- Die Wohngemeinschaft Emin Eller in Stuttgart-Rot;
- Kinder- und Familienzentren (KiFaZ)
- Sozialplanung in der Stadterneuerung;
- Lebenswertes Münster – Engagement auf Bezirksebene;
- Innen- vor Außenentwicklung – Potenzialanalyse Wohnen;
- Sauber unterwegs: Alternative Antriebe im Fuhrpark der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS);
- Konzept Wohnen in Stuttgart;
- Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) für eine soziale ausgewogene und städtebaulich qualifizierteBodennutzung;
- Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS);
- Grüne Infrastruktur – Spielflächen;
- Förderprogramm Urbane Gärten;
- NeckarPark – sozial-ökologische Stadtplanung
- Umsetzung der Agenda 2030 in den Gebieten der Stadterneuerung;
- „70599Lebenswert“ – Umsetzung der Agenda 2030 auf Bezirksebene;
- Temporäre Spielstraßen;
- Fußverkehrskonzept;
- Stuttgarter Mobilitätswoche;
- Green City Masterplan
- Die EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) – Unterstützung von Unternehmen;
- #jetztklimachen Reparaturkarte;
- Kreislaufwirtschaft in der Beschaffung (Textilien und Handtuchpapiere);
- 10 Jahre Fairtrade-Town Stuttgart;
- Lieferkonzept „letzte Meile“;
- Die CSRD zur Umsetzung bringen – und auf Nachhaltigkeit schalten;
- Zukunftsinvestition Gemeinwohl – Nachhaltig fit für morgen!;
- Öko-faire und soziale Beschaffung;
- Bieterdialog „Gut gehen und gut fühlen – Beschaffung von Arbeitsschuhen stadtweit“;
- Vollständige Biotage an Schulen der Landeshauptstadt Stuttgart
- Insektenfreundliche und energiesparende Straßenbeleuchtung;
- Lass es blühen! Gemeinsam für Insektenvielfalt;
- Bodenschutzkonzept Stuttgart (BOKS);
- Forschungsvorhaben „RAMONA – Stadtregiobnale Ausgleichsstrategien als Motor einer nachhaltigen Landnutzung“;
- Artenschutzkonzept der Landeshauptstadt Stuttgart;
- Verwaltungsleistungen online;
- Stuttgarter Kinderversammlung;
- Mobiles Arbeiten“;
- Projekt Arrival Ukraine;
- Fortbildung von städtischen Mitarbeitenden zu den Kinderrechten;
- Bürgerrat Klima;
- Betriebliches Gesundheitsmanagement als Wertschöpfungsbeitrag für eine starke Institution;
- Jugendbeteiligung „Mein DING!“;
- Leitlinien für informelle Bürgerbeteiligung;
- Bürgerhaushalt Stuttgart – Beteiligung der Einwohnerschaft an der Aufstellung des städtischen Haushaltplans;
- Gewaltpräventionsprojekt mit Migrantinnen für Migrantinnen (MiMi);
- Mobiles Arbeiten;
- Kinderpartizipation
- Jugendforum Internationale Stadt;
- Respektlotsenprojekt und Aktionswoche #Respekt0711;
- Solidaritätspartnerschaft Chmelnyzkyj – Stuttgart und „Dreier-Solidaritätspartnerschaft“ Chmelnyzkyj – Dresden – Stuttgart;
- Kommunale Klimapartnerschaft mit Menzel Bourguiba, Tunesien;
- Koordination globale Entwicklungsziele;
- Jugendpartizipationsprojekt „Local Empowerment – junge Akteurinnen und Akteure stärken und vernetzen“;
- Umsetzung von Verfahren zur umwelttechnischen Bewertung oberflächennaher Grundwasserressourcen in Bogotá D.C., Kolumbien;
- Cities for Mobility;
- Unterstützung von Geflüchteten auf Lesbos;
- #futureproofchallenge
Weitere Informationen und Daten-Download
Die Daten zur vierten SDG-Bestandsaufnahme können Sie hier herunterladen:
Daten vierte SDG-Bestandsaufnahme